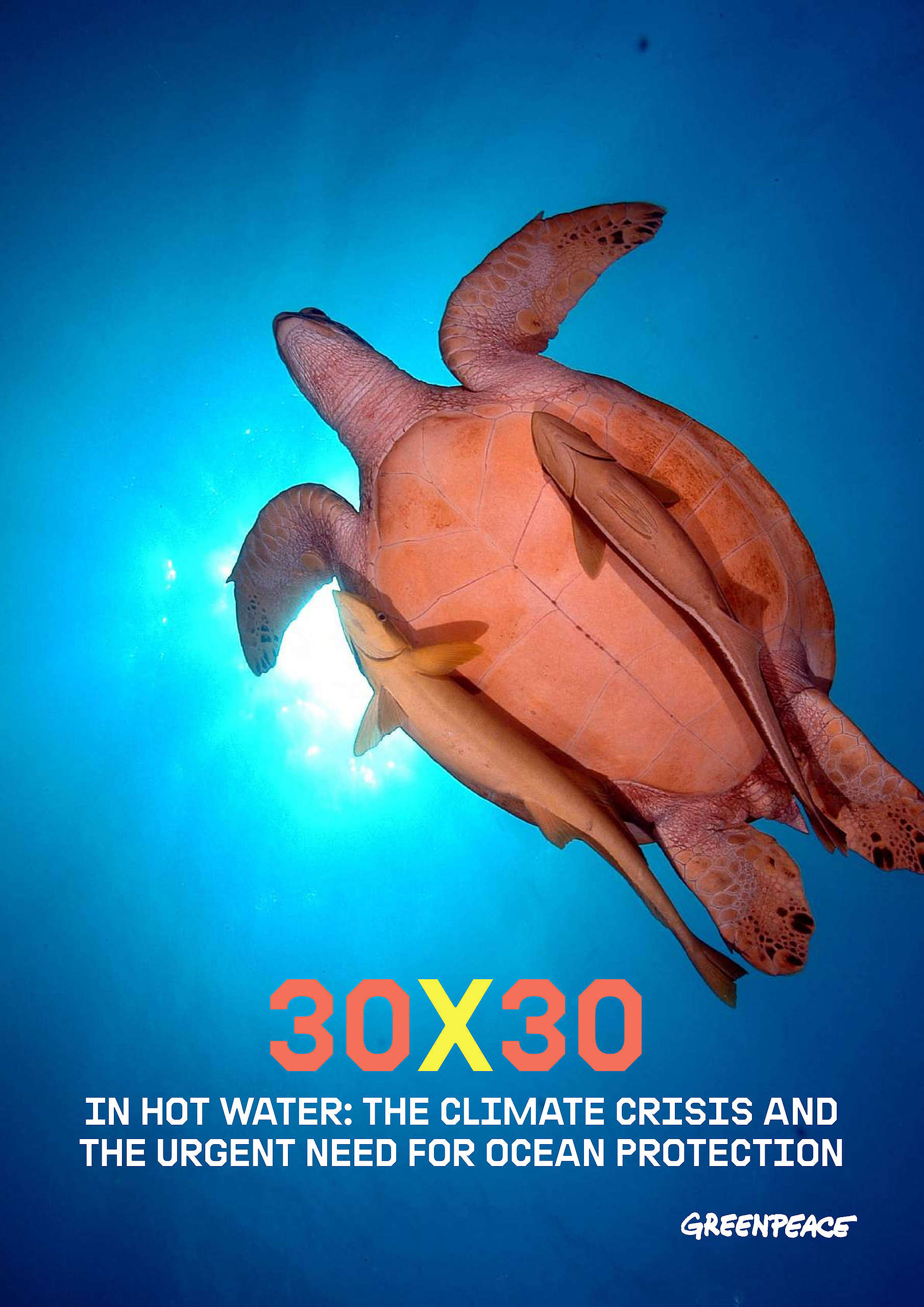Durch die Straße von Gibraltar fahren täglich bis zu 400 Schiffe. In der Meerenge leben auch Wale und Delfine. Eine kleine Organisation in dem spanischen Küstenort Tarifa versucht sie zu schützen. Eine Geschichte über Tiere und Menschen – und über das Warten.
«Man hörte ein Pfeifen, das nach und nach schärfer und stärker wurde und in ein Erdbebengetöse überging. Dann kam der Wind. Erst in einzelnen Böen, die aber immer häufiger wurden, bis eine unverändert anhielt, ohne Pause, ohne Linderung, mit einer Intensität und einer Gewalttätigkeit, die etwas Übernatürliches hatten.» So beschrieb Gabriel García Márquez den Landwind Tramontana an der nordöstlichsten Ecke Spaniens. Er hätte das auch über den Ostwind an der südlichsten Spitze des Landes schreiben können, am Ende des europäischen Festlands. Genau am äußersten Zipfel der Costa de la Luz, der Küste des Lichts, fegt er durch den Fischerort Tarifa, als wollte er ihn niederreißen.
Wir sind hierhergekommen, um die Wale zu sehen, die — ungeachtet des menschlichen Trubels an der Wasseroberfläche — hier leben. Aber der Wind hat entschieden, dass heute keiner den Hafen verlässt. Er peitscht den Sand und die Gischt über den Damm zur Isla de Las Palomas, der Mittelmeer und Atlantik voneinander trennt.
Levante, Levante. Das ist die Erklärung, die Entschuldigung, der Grund für alles. Die Bewohner Tarifas sagen es, wenn der Sand auf den Untertassen knirscht, die Kitesurfer denken es, wenn sie ihre Drachen startklar machen, die Fischer seufzen es, wenn sie nicht hinausfahren können. Genau wie die Whalewatcher. «Er brachte zwar die Mauren, aber er brachte auch den Duft der Wüste und der verschleierten Frauen. Er brachte den Schweiß und die Träume von Männern, die eines Tages ins Unbekannte aufgebrochen waren, auf der Suche nach Gold, nach Abenteuern — und den Pyramiden», schreibt Paulo Coelho in «Der Alchimist» über den Wind, den sie Levante nennen. Afrika ist nah. Die Landmassen Europas und Afrikas strecken sich hier einander entgegen, als wollten sie sich berühren. Nur 14 Kilometer fehlen ihnen.

Irgendwo da draußen schwimmen sie, die anthrazitfarben glänzenden Grindwale, die riesigen Finn- und Pottwale, die Delfine und vielleicht auch die schwarzweißen Orcas. Ähnlich wie wir Menschen an Land uns jetzt in den Wind lehnen, so kämpfen sie unter Wasser gegen die Strömung und gegen die Wellenberge, die beim Luftholen über ihnen zusammenschlagen. Sie werden erschöpft sein, wenn der Wind in einigen Tagen so plötzlich verstummt, wie er kam. Manche von ihnen werden sich an die Wasseroberfläche legen, mit der einen Gehirnhälfte schlafen und mit der anderen wachen.
Es gibt Leute hier, die kennen viele der Wale mit Namen. Am besten kennt sie wahrscheinlich Katharina Heyer. Wenn sie über das verstorbene Grindwalmännchen Curro spricht oder über den an der Finne verletzten Zackzack, dann klingt es, als rede sie von ihren eigenen Söhnen. Wir holen sie im Büro in der Altstadt ihrer Stiftung «Foundation For Information And Research On Marine Mammals», kurz «firmm», ab und gehen mit ihr die sechs Straßenbiegungen zum Hafenbüro. Wenn ihre Whalewatching-Boote nicht rausfahren können, ist es dort leer. Kein Besucher, kein Telefon, Luft zum Reden. Sie läuft Ideallinie, schräg über die holprig gepflasterten Gassen und eng an bröckelnden Hausecken entlang. Sie murmelt etwas von Zeiteffizienz und muss über ihre schweizerische Eigenheit schmunzeln. Jetzt, mit 71 Jahren, sitzen Gewohnheiten zu tief, um sie noch abzuschütteln. Die Frau aus dem Land der Uhren wird niemals eine Frau des Müßiggangs.
Vor 16 Jahren hat sie sich für die Wale entschieden und gegen ihr bisheriges Leben. Früher war sie die «Puma“-Frau, die als Taschendesignerin zu Spitzenzeiten achtmal im Jahr die Weltkugel umrundete. Jetzt ist sie die Walfrau, die besser mit den Tieren kann als mit den Menschen hier. «Ich bin die ewige extranjera, die ewige Fremde», sagt sie.

Tarifa ist kein Ort der offenen Arme. Immer wieder versuchen afrikanische Flüchtlinge die spanische Küste über die Meerenge zu erreichen, erleiden in der stürmischen See Schiffbruch, werden halb ertrunken an die Strände angespült und in knisternder goldener Aluminiumfolie an unsichtbare Orte geschafft, meist nachts. Wie viele von ihnen die Überfahrt nicht überleben, weiß nur das Meer. Das weiß getünchte Tarifa ist das Abwehren gewohnt, auch das von Schweizerinnen, die etwas bewegen wollen, so empfindet sie das.
Wir sitzen in dem Neubaubüro am Hafen auf kleinen weißen Holzbänken, an den Wänden hängen Reliefkarten von unterseeischen Gebirgen, Walposter und Fotos. Durch die großen Frontfenster sehen wir das weiße Ausflugsboot neben den bunt bemalten Fischerbooten im Hafen schaukeln. Katharina Heyer wird drei Stunden am Stück reden, ohne einen Schluck zu trinken, ohne die Festigkeit in ihrem Blick zu verlieren. Sie sieht nicht aus wie eine 71-jährige Frau, die schon seit Jahren in Rente sein könnte und in ihrem Leben wahrscheinlich doppelt so viel gearbeitet hat wie die meisten anderen.

Sie, die Geschäftsfrau aus einem Land ohne Küste, wollte den Andalusiern erzählen, «dass es hier Wale hat», wie man auf Schweizerdeutsch sagt. Etwas, was die Fischer schon lange wussten, weil sie die Meeressäuger oft bei ihren Fangfahrten sehen, aber offenbar versäumt hatten, ihren Mitmenschen zu erzählen. Katharina Heyer wusste, dass die Wale da waren, sie wollte, dass sie da waren und gleich bei ihrer ersten Ausfahrt mit einem Tauchboot entdeckte sie Grindwale, damals vor 16 Jahren. Bis zu sechs Meter große und drei Tonnen schwere Tiere, eine kleine Walart. «Schwarzer Kugelkopf» heißt ihr lateinischer Name übersetzt. Es ist ebenjener Wal, der jedes Jahr vor den Färöer-Inseln beim traditionellen Grindadráp gejagt wird. Sie sind relativ zutraulich und neugierig, bis heute sind sie ihre Lieblingswale.
Wenn sie von dem lang vergangenen Tag im Winter in der Meerenge erzählt, dann klingt es wie eine Sage. Sturm, Zeichen, plötzliche Gewissheit — das ist mein neues Leben, hier bei den Walen. Sie ist die missverstandene Heldin in der Geschichte, die sich dann entrollt. Kein Buch, kein Wissenschaftler, niemand weiß, was sie und die schweigsamen Fischer wissen: In der Straße von Gibraltar wimmelt es von Walen. Vielleicht ist es der Neid über ihre Entdeckung, vielleicht Missgunst gegenüber der reichen Ausländerin, vielleicht der Unwille, dass sich etwas ändert, der aus den Anfeindungen, Beschuldigungen, Sabotagen und Brandanschlägen spricht, die über sie ergehen. Die Schweizerin bleibt, in der Stadt, die niemals die ihre wird, bei den Menschen, denen sie sich niemals nahe fühlen wird. Obwohl sie es mag, in Vergleichen zu denken, ist ihr der eine noch nicht aufgefallen: Auch die Wale bleiben an einem Ort, der laut zu schreien scheint: Das hier ist kein Ort für euch! Und daran ist ausnahmsweise mal nicht der Wind schuld.

Es ist der Mensch und sein ungeheures Verlangen nach mehr Gütern und Mobilität. In der Meerenge werden die größten Tiere der Welt von den größten Transportmitteln der Welt verdrängt, manche enden wie Schmeißfliegen auf der Windschutzscheibe. Durch die Straße von Gibraltar führt eine der Hauptschifffahrtsrouten. Über das Mittelmeer, den Suezkanal und das Rote Meer sparen die Reedereien sich den Umweg um das Kap der Guten Hoffnung. Ein Großteil des Gütertransports zwischen Asien und Europa verläuft durch das Nadelöhr, hinzu kommen die Öltanker aus dem Nahen Osten. Das summiert sich zu Stoßzeiten schon mal auf 300 Schiffe am Tag. Noch nicht eingerechnet sind die Fähren zwischen Spanien und Marokko, die die Meerenge gute hundertmal am Tag kreuzen.
«Der Unterwasserlärm ist hier extrem stark», sagt Katharina Heyer. Bis zu 240 Dezibel habe ihr Team schon gemessen. Auch wenn Schall unter Wasser leiser erscheint als in der Luft, liegt das immer noch weit über der menschlichen Schmerzgrenze von rund 130 Dezibel. Der Lärm irritiert die Meeressäuger, die selber Geräusche zur Kommunikation und Orientierung aussenden. In einem Bereich unterhalb des Blaslochs erzeugen sie Pfiffe, Quiektöne und Klicklaute. Ähnlich wie Fledermäuse können sie sich durch das Echo ihrer ausgesandten Töne orientieren — solange sie nicht übertönt werden. Jedes Jahr kollidieren Wale mit Frachtern und geraten in Schiffsschrauben. Viele von ihnen tragen Narben von solchen Unfällen davon, einige überleben sie nicht. Der starke Geräuschpegel kann sogar innere Blutungen im Kopf verursachen, derart verletzte Tiere stranden orientierungslos an der Küste.
Es sind solche Vorfälle, die Jörn Selling wütend machen. Der 47-jährige Meeresbiologe ist ein menschgewordener Vulkan, am liebsten spuckt und wettert er gegen alles und jeden. «Wenn er rau ist, dann hat er gerade etwas erlebt, was ihn rau macht», sagt Katharina Heyer über ihren Kollegen. Das erlebt er hier häufig. Eines der größten Reizthemen des gebürtigen Uruguayers mit deutschen Eltern ist die Whalewatching-Konkurrenz. «Früher war das ganz schlimm, da sind die manchmal auf die Pottwale zugerast und aufgefahren, weil sie nicht mehr schnell genug bremsen konnten», erzählt er bei einem Strandspaziergang. Das gebe es heute nicht mehr. Pause. «Naja, vielleicht wird’s ja besser.» Mit «firmm» erforscht er die Walpopulationen in der Meerenge und begleitet die Beobachtungsfahrten für Touristen. Respekt vor den Tieren ist der Organisation wichtig, den Abstand zum Boot sollen die Wale selbst bestimmen können. Natürlich ist das «firmm»-Boot ein weiteres Gefährt im Wasser, Jörn Selling macht sich deswegen Gedanken über ein ideales Boot, das die Tiere möglichst wenig stört.

Er ist hager und braungebrannt, seinen Bart hat er sich zu breiten Koteletten geschnitten, die Haare sind verfilzt vom salzigen Wind. Er streift sich seinen blauen Strickpullover über, er muss los, die Katzen füttern. Jeden Morgen und jeden Abend kreuzt er mit seinem rumpeligen VW-Passat durch Tarifa, um den Straßenkatzen Futter und Wasser zu bringen, unzählige von ihnen hat er kastrieren und sterilisieren lassen. Neben Mülltonnen, hinter Eisengittern und auf Brachflächen warten sie schon auf ihn. Er zischt ein paar Mal durch die Zähne, dann kommen sie und streichen ihm um die Beine. Für ihn ein kurzer Moment der Zufriedenheit. «Ich habe aufgegeben, mein Glück finde ich nicht mehr», sagt er, sein Gesicht eine zynische Maske. «Meine Aufgabe ist es, anderen Leuten in den Arsch zu treten.»
Den Walen wird er nicht so leicht helfen können wie den Katzen. Erstere finden in der Straße von Gibraltar nämlich, abgesehen vom menschlichen Chaos, perfekte Bedingungen. Weil das Mittelmeer circa anderthalb Meter tiefer liegt als der Atlantik, fließt an der Oberfläche der Meerenge beständig Wasser Richtung Osten. Eine Tiefenströmung am Meeresgrund bringt schweres salzhaltiges Wasser zurück in den Atlantik und stürzt über eine Schwelle mehrere hundert Meter in die Tiefe. Diese Wasserbewegungen und das Sonnenlicht bringen die perfekten Lebensbedingungen für Plankton und Krill — die Nahrung der Bartenwale. Die Zahnwale fressen die Fische, die die kleinen Fische gefressen haben, die Krill und Plankton gefressen haben. Diese Nahrungskette scheint den Meeressäugern wichtiger zu sein als Ruhe vor dem Lärm.

2007 sah es danach aus, als habe «Rettet die Wale» über «Zeit ist Geld» gesiegt. Die spanische Regierung erließ für die Straße von Gibraltar ein Tempolimit von 13 Knoten (24 Kilometer pro Stunde). Die kleine Organisation «firmm» schwelgte in Euphorie — «Aber es handelte sich dabei bloß um eine Empfehlung», sagt Katharina Heyer. Und die hält natürlich niemand ein, solange Zeit eben doch Geld ist. Immerhin einen Erfolg können sie feiern: Die Fähren nach Marokko haben sie dazu bewegen können, ihre Routen aus den Walgebieten zu verlegen.
Viele von ihnen steuern den 2008 eröffneten Tiefwasserhafen Tanger Med an — den größten seiner Art in Afrika. Er ist das marokkanische Prestigeprojekt und soll kräftig wachsen, um Tanger zum Tor Afrikas zu machen. Spanien auf der gegenüberliegenden Seite versucht mit seinem Hafen in Algeciras Kundschaft anzuziehen, in der gleichen Bucht lockt die britische Enklave Gibraltar mit günstigem Schweröl. In den Gewässern des Steuerparadieses lassen sich viele Frachtschiffe per Tankschiff volllaufen. Gerissene Tankschläuche und Lecks sind keine Seltenheit, manche sprechen sogar von einer schleichenden Ölpest an der andalusischen Küste.
Weil die Bucht von Algeciras windgeschützter ist als die offene Meerenge, können wir dem Levante dort eine Bootsfahrt abtrotzen. Die Wellen spritzen an die Seiten, der Motor surrt, Kapitän Pedro und sein Gehilfe Diego singen mit tiefen Stimmen in der Fahrerkabine. Wir passieren tankende Frachter und schaukeln in den Wellen einer Fähre. Gewöhnliche Delfine nähern sich und schwimmen in der Bugwelle — für sie kein Problem, sie gehören zu den schnellsten Waltieren überhaupt und können bis zu 65 Kilometer pro Stunde schwimmen. Eine Schule Gestreifter Delfine taucht springend aus dem Wasser auf, sie leben oft gemeinsam mit den Gewöhnlichen Delfinen. Beide lassen sich nicht dressieren, im Gegensatz zum Großen Tümmler, der zu seinem Leidwesen in Delfinarien und Filmen Kunststücke zur Schau stellen muss.
Das beste Auge auf der Suche nach Tieren hat Eduardo Montano, er begleitet Katharina Heyer auf jeder Ausfahrt. An Tagen des Levante hat er Zeit zum Reden. Wir treffen uns im Café eines Freundes in einer kleinen Seitenstraße der Altstadt, wir sind die einzigen Gäste. Er bestellt einen Tee, den er nicht austrinken wird.

Er wurde zum marinero geboren, zum Seemann, schon sein Vater war Fischer. «Als ich klein war, war die Meerenge voll von Tieren», erinnert sich der 42-Jährige, dessen Haut schon im Frühling nach Hochsommer aussieht. Kabeljau, Sardinen, Makrelen, Große Rote Drachenköpfe, «es ist traurig, dass man die hier nicht mehr sieht». Anfangs fuhr er mit dem Fischerboot raus, dann fing er bei der Almadraba an — einer traditionellen Form des Thunfischfangs, bei der sich die Fische in einem Netzlabyrinth verirren. Sie werden mit Booten eingekesselt, bis das Wasser vor zappelnden Thunfischen kocht. Die Fischer ziehen einen nach dem anderen der bis zu dreihundert Kilo schweren Kolosse aus dem Wasser, ein Job für harte Männer. «Das ist wie ein Stierkampf, nur nicht mit einem Stier, sondern mit zweihundert Thunfischen.»
Der Wechsel zu «firmm» war für ihn «ein Wechsel von Nacht zu Tag», sagt er. Seine heutige Nachdenklichkeit kann er mit den meisten Kollegen von früher nicht teilen, «ich habe ja damals auch wie ein Fischer gedacht.» Jetzt glaubt er nicht mehr, dass die Tiere der Meerenge noch zu retten sind, einzig die wachsende Grindwalpopulation gibt ihm Hoffnung. «Wir Fischer wussten schon damals, dass es einmal aufhören würde.»
Inzwischen hat jedes Fischerboot eine Fangquote, tausend Kilogramm Thunfisch im Jahr. Das sind gerade einmal drei bis vier Tiere. Ungefähr zehn Euro bekomme er für ein Kilogramm Thunfischfleisch, erzählt uns Manolo Mesa, 40, geborener Fischer wie so viele hier. Er zeigt uns seine Werkstatt in einer Garage im Westen Tarifas, die Köder, das selbstgebastelte Werkzeug, die unterschiedlich dicken Schnüre. Auch er gehört zu den Leuten, die bei Levante viel Zeit haben. Er lädt uns in seinen Van ein, Passbilder von Mutter und Vater auf dem Armaturenbrett, und fährt uns zum Hafen. Wir laufen durch die Reihen der bunten Holzboote und bleiben vor einem türkisfarbenen stehen. Ein brauner zotteliger Hund springt davor aufgeregt auf und ab. Es ist der Hund seines sechs Jahre älteren Bruders, der hinten auf dem Boot sitzt.
Die Fischer haben wahrscheinlich schon mehr Orcas gesehen als jeder Whalewatcher, denn sie haben, was die Wale wollen: Thunfisch. «Im Juni kommen sie“, erzählt Manolo Mesa. «Sie warten, bis wir den Thunfisch an der Leine ermüdet haben.» Dann beißen sie zu. Die Fischer ziehen nur noch den Kopf ihrer Beute aus dem Wasser, den lassen die Orcas dran, weil sie gelernt haben, dass da der Haken ist. Die Schwertwale sind langsamer als die Thunfische, warum sich also unnötig Mühe machen, wenn das Essen doch schon so hübsch aufgefädelt ist? Manolo und sein Bruder Rafael Mesa versuchen, die schwarz-weißen Wale mit Klopfen am Boot zu vertreiben, erzählen sie, «aber du darfst ihnen nichts tun», sagt Manolo. «Der alte Mann und das Meer» von Ernest Hemingway ist ihre Geschichte, nur dass dessen Hauptfigur Santiago die Haie ersticht, die seinen Fisch klauen.
Andere Fischer, wie der 57-jährige Rafaél Gamero Diaz, den wir zufällig auf dem Weg treffen, werfen mit Steinen nach den Räubern. «Der Orca ist verrückt und gefährlich», sagt er mit eindringlichem Blick. «Der Orca hat immer Hunger.» Vor sechs Monaten habe einer sein Boot angegriffen, immer wieder habe er es gerammt. Das sei das einzige Mal gewesen, dass er Angst vor dem Wal gehabt habe. Er schmunzelt vergnügt. Töten würde er einen Orca aber nie. Nur Thunfische, das sei nun mal sein Job.
Nach fünf Tagen Sturm ist es über Nacht still geworden in Tarifas Straßen. Der Hafen ist leer, die Fischer sind ausgefahren. Und wir steigen nun auch endlich auf unser Boot. Lange fahren wir durch die noch immer aufgewühlte See, ohne ein Tier zu erblicken. Dann nähern sich Gestreifte Delfine, und während wir ihnen noch beim Springen zusehen, sind sie auf einmal da: Grindwale. Schwarz glänzend heben sich ihre Finnen aus dem Wasser, die Jüngeren heben neugierig ihre Köpfe aus den Wellen. Sogar eine Paarung können wir beobachten. Dann plötzlich hebt sich eines der Tiere senkrecht weit aus dem Wasser und pfeift.
Ob die Wale das Boot in den Tagen des Windes vermisst haben? Ob sie froh sind, dass der Sturm vorbei ist? Ob sie sich über den Lärm unter Wasser beschweren? Das bleibt ihr Geheimnis, denn zum Glück kann der Mensch nicht alles verstehen.
Mehr zum Thema finden Sie hier:
- Firmm (Foundation For Information And Research On Marine Mammals)
Der Artikel «Bedrängte Giganten» erschien ursprünglich im deutschen Greenpeace Magazin, Ausgabe 4.14.