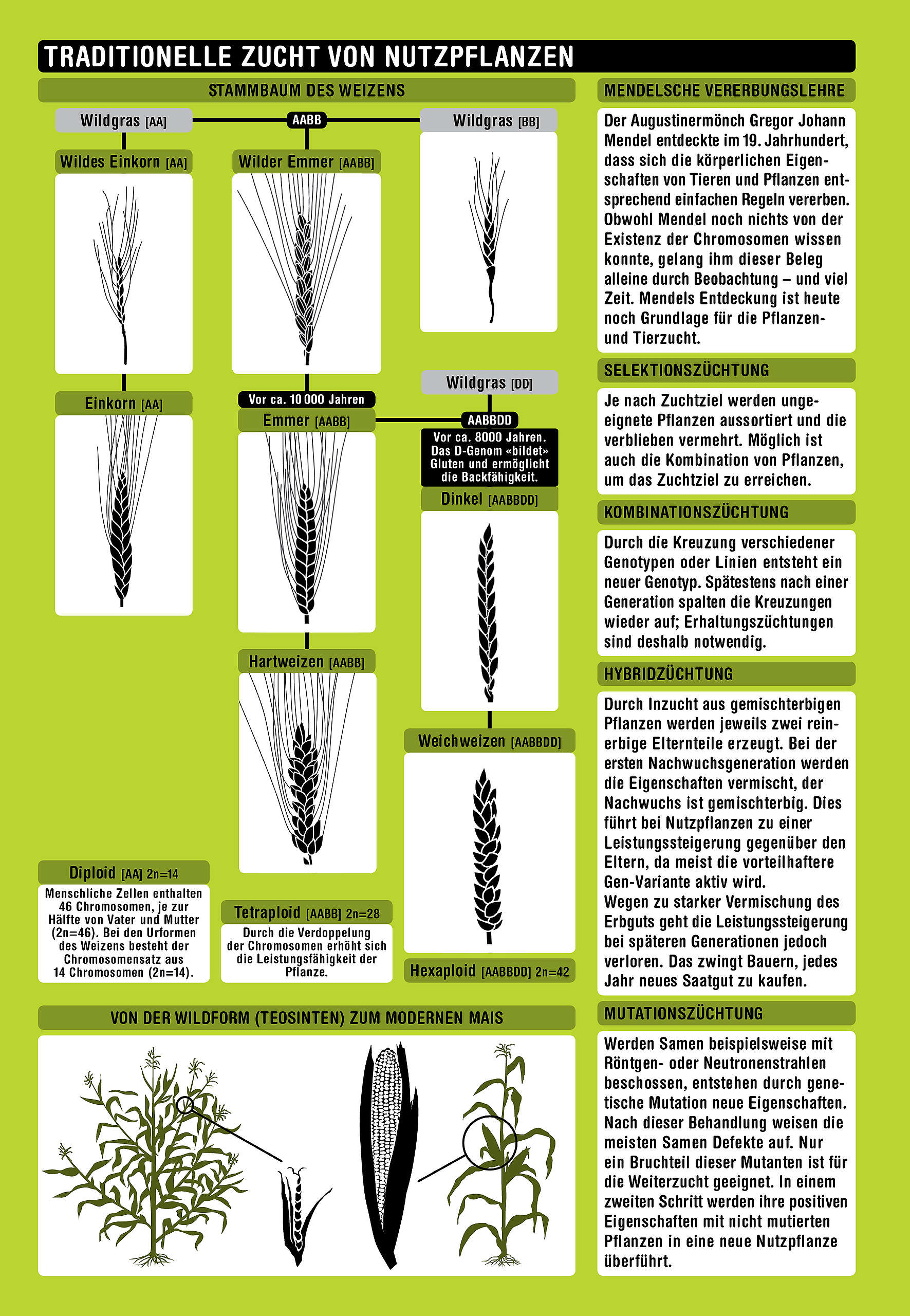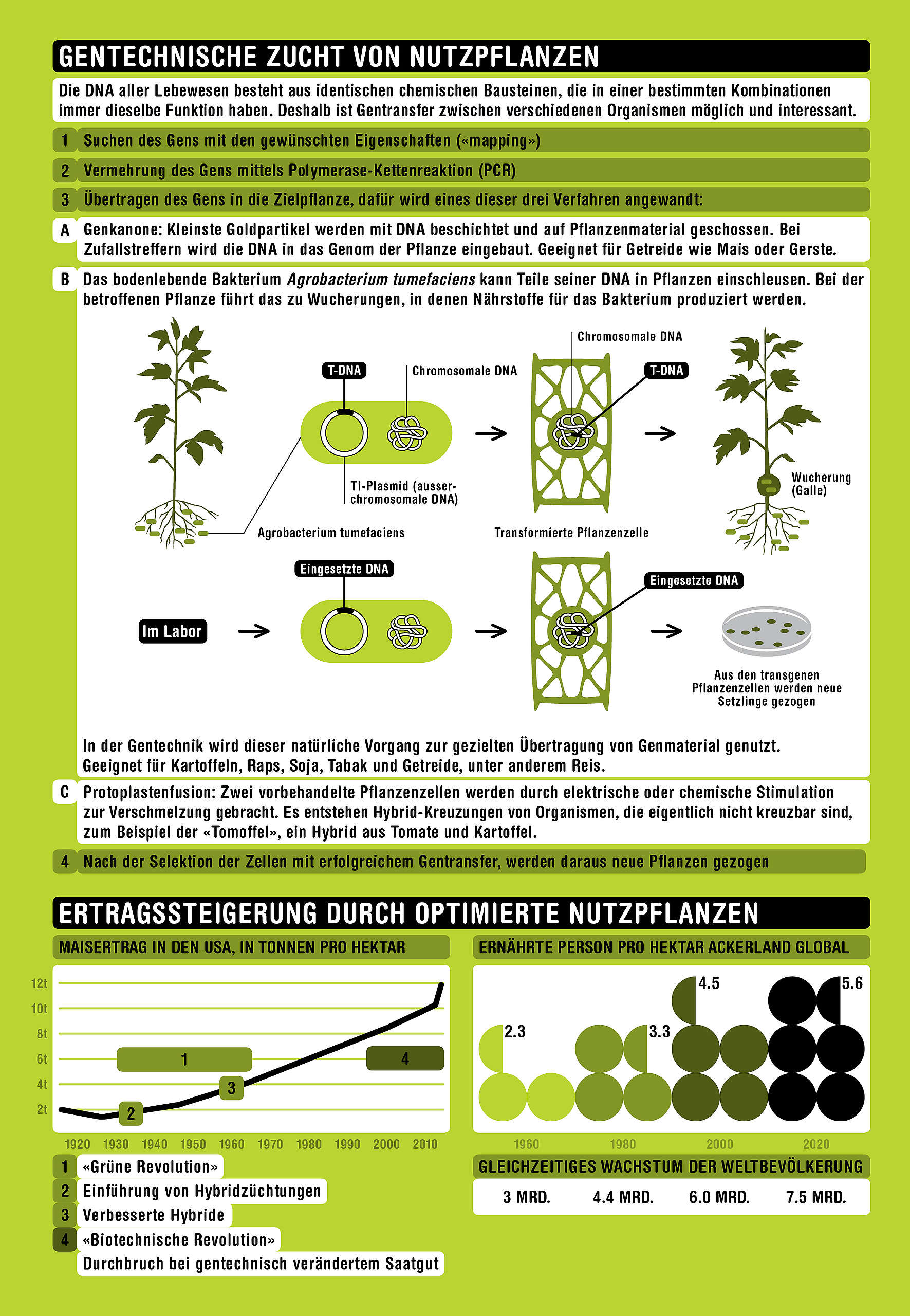Wie der Basler Agrarkonzern versucht, den Bewohnern einer Insel die Demokratie zu rauben.
Bernard Carvalho greift sich den Zettel mit den Namen darauf, den ihm seine Stabschefin reicht, fährt mit seinem Finger über die obere Hälfte der Namen und stoppt in der Mitte. «Die untere Hälfte ist raus.» Ersten Auszählungen nach ist die Wahl seines neuen Gemeinderates viel besser gelaufen, als der Bürgermeister es sich gewünscht hatte. Sein Gesicht zeigt die Freude eines Kindes, das soeben mit einem Streich davongekommen ist. «Das wird einige schockieren», sagt er noch immer grinsend und bemüht sich um staatsmännische Haltung. Er zieht ein weisses Tuch aus seiner Tasche, wischt sich eine grosse Menge Schweiss von der Stirn, steckt das Tuch zurück, richtet seinen Rücken auf und wirft mit beiden Händen die Glastür zum Bürgerzentrum auf. Seine Wahlparty ist in vollem Gange. Auf der Bühne greifen zwei Männer in die Saiten und lassen spanische Gitarrenmusik erklingen. Unter einem Dach orange- und türkisfarbener Ballons singt eine schöne, alte Frau eine fröhliche Version des Broadway-Songs On A Clear Day You Can See Forever. Auf einem Banner hinter ihr steht geschrieben: Carvalho — Action with Aloha. An langen Holztischen essen Dutzende seiner Anhänger ein spendiertes Dinner. Ein paar Köpfe drehen sich zur Tür, wo Carvalho seinen mächtigen Körper in den Saal wuchtet. Kein Zweifel: Das wird sein Abend werden.
Die letzten 18 Monate sind aufreibend gewesen. Bürgermeister Carvalho hat sich mit allen Mitteln gegen eine Revolte gestemmt, wie sie die Hawaii-Insel Kauai noch nie zuvor gesehen hatte. Angezogen vom idealen Klima und einer der fruchtbarsten Erden weltweit, begannen während des letzten Jahrzehnts Firmen wie Syngenta, Dow oder BASF die Pazifikinsel Kauai in das grösste Gen-Pflanzen-Labor der USA zu verwandeln. Auf über 10 000 Hektar forschen sie nach neuen Sorten. An keinem andern Ort der USA führen diese Firmen mehr Feldversuche durch. Carvalho hat sie mit offenen Armen empfangen und bisher mit allem verteidigt, was in seiner Macht stand. Das wurde nötig, weil die Inselbewohner der verarmten Westseite rebellierten. In den Fokus der Volkswut geriet insbesondere Syngenta. Den Agro-Giganten aus Basel kennt hier jedes Kind, man ist der Meinung, dass er Tausende Kilometer von seiner Heimat entfernt rücksichtslos Pestizide spritzt und sich nicht um die Gesundheit der Bewohner schert und dass der Konzern mit Millionen an Spendengeldern die Politik zu seinen Gunsten beeinflusst. Ihre Hoffnung setzten die Biotech-Gegner in einen schillernden ehemaligen Senator aus Honolulu, Gary Hooser. Er wollte im Gemeinderat der Insel die Macht der Konzerne mit einem neuen Gesetz begrenzen, für das die Gemeinde von Syngenta vor Gericht gezerrt wurde. Am heutigen Wahlabend, es ist der 4. November 2014, wird sich zeigen, ob er im siebenköpfigen Rat die Macht behalten kann.
Der Abend hat erst angefangen, die Stimmen sind noch längst nicht fertig ausgezählt. Es strömen immer mehr Unterstützer zu Carvalho, als wir seine Wahlparty in Kauais Hauptort Līhuʻe durch die Hintertür verlassen, um zur nächsten zu gehen. Der Highway 56 ist gesäumt von Palmen und führt auf einer kurvigen Strasse am Meer entlang in den Norden, zur Wahlveranstaltung der leidenschaftlichsten aller Syngenta-Gegner. Noch schöner ist nur der Anblick aus der Luft: Fliegt man von Hawaiis Hauptinsel Oahu auf Kauai, glaubt man zuerst an eine Illusion im Pazifik. Kauai ist fast kreisrund mit dem 1598 Meter hohen Berg Waiʼaleʼale in der Mitte. Vor sechs Millionen Jahren hat sich Kauai als erste der hawaiianischen Inseln aus dem Meer gestemmt. An manchen Tagen hängt ein leichter Nebel über dem Gebirge, nur um sich in wenigen Minuten zu verziehen und den Blick auf eine tropische Idylle freizugeben. Die hügelige Landschaft ist mit einem Teppich aus sattem Grün überzogen, dann und wann unterbrochen von rostroten Flecken. Es wächst Kaffee, Palmen überall, Ananas, Mangos, an manchen Stellen stürzen sich Wasserfälle in 900 Meter tiefe Schluchten. Kein Wunder, nennen die Einheimischen ihre Heimat stolz die Garteninsel. Trotz der einen Million Besucher, die jedes Jahr auf die Insel strömen, ist sie noch nicht vom Tourismus überlaufen.
Auf dem Highway 56 hupen sich die Menschen zu, bald kommen wir ganz oben im Norden an. Klippen ragen aus dem Meer, um kurz darauf schneeweissem Sand Platz zu machen. Das Meer hier ist smaragdgrün und wild. Surfer lieben die Gegend. Millionäre auch. Berühmtheiten aus Hollywood wie Bette Midler oder Silicon-Valley-Ikonen wie Mark Zuckerberg liessen üppige Villen in die Hänge bauen und schufen sich ihr privates Paradies.
Etwa 250 Menschen haben sich zur Wahlparty der Syngenta-Gegner in einem grossen weissen Zelt versammelt, Lichterketten leuchten, aus Lautsprechern dringt stimmungsvolle Musik. Ihr Anführer ist Gary Hooser, ein kleiner Mann mit einem kleinen Bauch und stechenden, blauen Augen. In Honolulu stieg Hooser als Senator rasch zum Mehrheitsführer auf, erlitt aber beim Versuch, Gouverneur zu werden, eine Niederlage. Hooser ist ein findiger Politiker, der nach seiner Rückkehr auf die Insel im Gemeinderat viel erreicht hat und im Westen Kauais mit dem wachsenden Unmut der Bevölkerung über den massiven Pestizideinsatz von Syngenta eine Anti-Gentech-Protestbewegung aufbaute, die jener Europas Ende der neunziger Jahre glich. Syngenta und den anderen Biotech-Firmen wurde Hooser zunehmend gefährlich.
Gerade als er zur Feier stösst, wirft ein Projektor die ersten Wahlresultate auf eine Leinwand. Und sie wirken, als hätte jemand eine feuchte Decke über ein Lagerfeuer geworfen. Die Zahlen prognostizieren einen klaren Sieg für Carvalho und eine ebenso klare Niederlage für Hooser.
Dabei schien alles für die Gegner zu laufen. Nachdem ganze Schulen nach Pestizid-Einsätzen der Biotech-Konzerne hatten evakuiert werden müssen und Mediziner eine ungewöhnliche Häufung von Geburtsfehlern festgestellt hatten, war die öffentliche Meinung gegen die Konzerne gekippt. Obwohl sich einige der mächtigsten Politiker und stärksten Biotech-Unterstützer im Staat in die Lokalpolitik einmischten, schien Hooser mit seiner Bewegung der Favorit der kleinen Tropeninsel mit ihren 65 000 Bewohnern zu sein.
An einem Tag Mitte November 2006 bog Matt Snowden, seine Haare noch nass vom morgendlichen Surfen, in den Parkplatz der Waimea-Canyon-Schule im Westen der Insel ein. Snowden, ein gross gewachsener Typ mit einem feinen Gesicht, das spitzbübisch und ernst zugleich wirkt, sollte gleich Englisch unterrichten. Er durchquerte den Campus, eine Ansammlung von kleinen, weissen Container-Häuschen mit blauen, flachen Dächern. Auf halbem Wege zum Klassenzimmer blieb Snowden kurz stehen. «Es riecht merkwürdig», dachte er sich, wischte den Gedanken aber wieder weg, das war in den letzten Tagen öfter vorgekommen. Zwanzig Kinder strömten in das Klassenzimmer, es war heiss und feucht. Snowden drehte sich zur Wandtafel — da erwischte es ihn. Er beschrieb das Gefühl den Ermittlern später als «mentale Schwäche», als hätte jemand sein Hirn ausgeschaltet. «Ich wusste plötzlich nicht mehr, was ich an der Wandtafel wollte», gab er zu Protokoll. Der Geruch war stärker geworden. Im Klassenzimmer stank es nach Chemie, nach Benzin. «Herr Snowden», rief eine kleine Blonde und reckte ihre Hand in die Luft, ihre Augen weit aufgerissen. «Herr Snowden, mir ist schlecht.» Snowden schickte sie ins Krankenzimmer, gleich darauf begannen sich weitere Schüler zu beschweren. Sie rieben sich die Augen, putzten sich immer wieder die Nase. Die kleine Blonde schaffte es nicht bis zum Krankenzimmer und übergab sich auf dem Weg dorthin. Auf dem Campus brach Chaos aus. In den Armen eines anderen Lehrers sackte eines der Kinder zusammen. Kinder und Lehrer rannten in die Bibliothek, den einzigen Raum auf dem Campus mit einer Klimaanlage.
«Es sah aus wie in einem Kriegsgebiet. Die halbe Schule drängte in die Bibliothek», beschrieb Howard Hurst, ein anderer Lehrer, die Szene. Er flüchtete mit seinen Schülern auf einen Grashügel am östlichen Ende des Campus. So weit wie möglich weg von den Feldern hinter der Schule — den Feldern von Syngenta.
Immer wieder hatten Hurst und seine Klasse in den vergangenen Tagen aus ihrem Zimmer die Traktoren gesehen, wie sie sprühten, und sie hatten sie gehört: Tsssssss. Tsssssss. Nun war etwas schiefgegangen, daran hatte Hurst keine Zweifel. Zwei Männer von Syngenta eilten auf den Campus. Der eine war der Arbeiter, der kurz zuvor das Feld hinter der Schule mit einem Unkraut-Killer besprüht hatte. Würde man den Zusammenhang zwischen dem Unfall und dem Sprüheinsatz mit Chemikalien beweisen können, wäre er persönlich haftbar. Der Sprüher von Syngenta hatte ein paar Pflanzen ausgerissen und streifte nun durch den Campus, um sie Kindern und Lehrern unter die Nase zu halten: Cleome gynandra, bekannt unter dem Namen «Stinkkraut». Ein Unkraut, kaum kontrollierbar, das in einigen Staaten der USA, in Indien und in Afrika wächst. «War es das, was ihr gerochen habt?» Die Kinder und Lehrer waren sich nicht einig. Kurz darauf informierte die Schulvorsteherin die Eltern, «dass ein Unkraut auf der Westseite der Schule einige Kinder krank gemacht hat. Wir rotten es aus.» Die Schule blieb für den Rest der Woche geschlossen.
An den Tagen und Wochen danach war Waimea wie verkatert. Was war passiert? Die Lehrer glaubten keine Sekunde an die Stinkkraut-Theorie. Und sie waren nicht allein. «Ich glaube nicht, dass das Stinkkraut war», sagte der Kinderarzt Jim Raelson. «Die Frage ‹Hatten Sie Kontakt mit Stinkkraut?› gehört nicht mal zu den Top-200-Fragen, die man stellt, wenn jemand mit den Symptomen dieser Kinder in einer Praxis auftaucht.» Doch genau das stand als Grund für den Vorfall in einem dicken Report. Wer ihn lesen will, muss offiziell in Honolulu einen Antrag stellen, doch viele Sätze sind geschwärzt. Daraus geht hervor, dass Syngenta am Tag vor dem Vorfall eine Menge Gift gesprüht hatte. Knapp ein Pfund Atrazin auf einem halben Hektar, deutlich mehr als beispielsweise in Iowa, dem US-Staat mit den höchsten Pestizidgrenzwerten. An den Fenstern der Schule, so der Report, wurde zudem ein viermal höherer Atrazin-Wert gemessen als an anderen Stellen. Einige Dutzend Kinder erkrankten und mussten nach Hause geschickt werden. Doch die Ermittler fanden «nicht genügend Beweise, dass Syngenta Pestizide in einer Art und Weise angewendet hat, die gegen das Pestizid-Gesetz Hawaiis verstossen».

Die Zeit verging, in den Klassenzimmern der Waimea-Canyon-Schule waren die Traktoren zu hören, wie sie sprühten. Tsssssss. Tsssssss. Und bald passierte es wieder. Am Morgen des 25. Januar 2008, über ein Jahr nach dem ersten Vorfall, kam Matt Snowden früher als sonst in die Schule. «Ich ging in mein Klassenzimmer und riss die Fenster auf und roch wieder diesen chemischen Geruch.» Während einer Sportstunde im Freien knickten Schüler ein, einige erbrachen. Die Schule wurde evakuiert, zwölf Kinder und ein Lehrer ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittler identifizierten die Ursache noch am selben Tag: «Stinkkraut.» Nun kochte die Wut über. Es war der Moment, in dem Gary Hooser die Chance für sein politisches Comeback witterte. Er koordinierte die Biotech-Opposition und entwarf ein Gesetz, welches den Pestizidgebrauch auf Kauai reduzieren sollte. Syngenta konterte mit einem Deal: Um das Gesetz zu verhindern, gab der Konzern die Felder neben der Schule auf. Ein verschmerzbarer Verlust. Schliesslich blieben Syngenta und den anderen Saatgutfirmen im Westen Kauais noch viele Tausende Hektar Land. Die Konzerne sind um die Jahrtausendwende dem Ruf der Regierung und der Grossgrundbesitzer gefolgt, als der grössten Arbeitgeber der Insel, die Ananas- und Zuckerindustrie, in den neunziger Jahren untergingen. Die alte Zuckermühle mit ihrem Turm, der über das Dorf Kekaha ragt, erinnert an die einstige Macht dieser Industrie. Sogar die Palmen sehen in diesem Teil der Insel ärmlich aus, verblasst und gelblich statt satt und grün. Das Gras vor den Häusern ist nicht wie auf der anderen Inselseite perfekt manikürt, sondern mit Erdlöchern gespickt.
Syngentas unscheinbarer Hauptsitz befindet sich in ein paar weissen Containern hinter einem Stahltor am Rande des Highway 50. Abgesperrt und mit Videokameras überwacht. NO TRESPASSING steht auf einem Schild. Das gilt auch für Journalisten. Doch über einen kleinen Landweg, der sich in den Hängen am anderen Ende der Felder verbirgt, kann man sich auf das abgesperrte Land stehlen. Die Felder lassen nicht erahnen, dass hier Hightech-Produkte wachsen. Vor dem Feld 212 steht ein rotes Schild. Eine Fratze in Schwarz hält darauf eine Hand hoch. Auf einem kleineren Schild steht gekritzelt, dass hier vor gut acht Stunden ein Mix aus Chemikalien gespritzt worden ist. Der Mix schützt den Mais vor Schädlingen. Drei, vier Felder weiter wächst Babymais unter dem Schutz eines weissen Tuches. Ein winziges Feld. Es ist brennend heiss. Noch ein Schild. Dahinter totes, braunes Gewächs. 48 Stunden lang dürfe man dieses Feld nicht betreten, steht in Handschrift unter dem Schild.
Als Forscher es geschafft hatten, die Genstruktur von Pflanzen so zu verändern, dass sie neue Eigenschaften besassen, begann für die grössten Biotech-Firmen ein goldenes Zeitalter. Pflanzen konnten nun ein Protein entwickeln, das für Schädlinge giftig war. Wenn beispielsweise der Maiszünsler, ein brauner Schmetterling, von einem Maiskolben ass, starb er sofort. Das Bakterium Bacillus thuringiensis, von dem diese Eigenschaft kopiert wurde, gab der Pflanze ihren Namen: Bt-Mais. Auch neue Arten von Pflanzen, die gegen bestimmte Chemikalien resistent waren, kamen in der Folge auf den Markt. Bauern konnten damit ihre Saat unbesorgt mit Pestiziden besprühen, und während die Schädlinge vernichtet wurden, blieben die heranwachsenden Pflanzen unbeschadet. In den USA gibt es kaum noch ein Mais-, Baumwoll- oder Sojabohnen-Feld, das nicht mit genetisch veränderten Samen bepflanzt ist. Auch Europa profitiert stark von diesem Boom. Während genetisch veränderte Lebensmittel für den menschlichen Konsum noch weitgehend verboten sind, werden Tiere mit Millionen Tonnen von importierten, genetisch veränderten Lebensmitteln gefüttert. Die meisten dieser Pflanzen stammen ursprünglich von den Feldern hinter dem stählernen Zaun am Highway 50.
Wir wandern weiter durch die Felder. Zwischen den Pflanzungen stehen überall grüne Dixi-Klos, in der Ferne ist ein Traktor zu sehen. Nach einer Weile treffen wir auf ein paar Männer, die gelangweilt auf Klappstühlen sitzen. Einer erhebt sich, er trägt schlecht sitzende, löchrige Jeans und ein rotes T-Shirt. Sein Rücken ist krumm. «Ich bin seit sechs Uhr morgens hier. Wenn es dunkel ist, gehe ich wieder», antwortet er auf unsere Frage, was denn sein Job sei. Sein Akzent verrät, dass er von den Philippinen stammt. «Ich bin ein Ernteschutzspezialist.» — «Du schaust, dass Vögel den Mais nicht fressen?» Er lacht. «Genau. Ich bin eine menschliche Vogelscheuche. So nennen sie uns.»
Was menschliche Vogelscheuchen nicht vermögen, erledigt der Unkrautkiller S-Metolachlor. Das Gift ist eine Schweizer Erfindung. Es wurde von Ciba-Geigy entwickelt, der Firma, aus der die heutige Syngenta hervorging. Es gibt keinen Ort in der westlichen Welt, an dem mehr S-Metolachlor gespritzt wird, als von Syngenta auf Kauai. Hier ist es Syngentas Lieblingswaffe gegen Unkraut. 1172 Pfund pro Jahr und Quadratmeile werden durchschnittlich eingesetzt, fast doppelt so viel wie auf dem US-Festland. Von keinem anderen Gift braucht Syngenta mehr. An zweiter Stelle folgt Atrazin. Ein weiteres hauseigenes Gift, verboten in Europa. 563 Pfund Atrazin pro Quadratmeile sprüht Syngenta pro Jahr. Das ist mehr als in Iowa, im Mais-Staat Nummer eins der USA, und deutlich mehr als in der Schweiz versprüht wurde, als Atrazin dort noch legal war; das zeigt eine Studie der Universität Lausanne. Sie untersuchte zwei Felder im Kanton Zürich, die für ihren hohen Atrazin-Gehalt bekannt waren. Vergleicht man die Zahlen aus der Lausanner Studie mit jenen von Kauai, welche durch die US-Behörden ermittelt und durch die Washington State University erstmals veröffentlicht wurden, so wird in Kauai bis zu 30 Mal mehr gespritzt.

Die amerikanischen Farmer lieben Atrazin. «Atrazin ist wie eine Bombe», erzählte uns eine Chemikerin, die bei Syngenta und beim deutschen Konkurrenten BASF auf Kauai gearbeitet hat, aber namentlich nicht genannt werden möchte. «Es ist ein grossartiges Werkzeug. Aber es gibt keinen guten Grund, es so stark einzusetzen, wie das Syngenta tut, ausser Faulheit», sagte sie. «Als ich bei BASF gearbeitet habe, diskutierten wir viel mehr und kritischer darüber, welche Pestizide wir wie oft anwenden sollten.» Auch die Einsatzmengen der hochgiftigen und in der Schweiz mittlerweile ebenfalls verbotenen Insektizide Chlorpyrifos und Permethrin sind hier 10 Prozent höher, bei letzterem sogar 16 Prozent als auf dem Festland.
Konfrontiert mit den Zahlen aus Washington, besteht Syngenta darauf, dass die Firma die «sichere und verantwortungsvolle» Nutzung von Chemikalien als zentral ansieht. «Weil wir in Hawaii drei oder vier Ernten pro Jahr pflanzen können, setzen wir sogar weniger Produkte ein als Farmer auf dem Festland», schrieb Syngenta-Sprecherin Savina LaScalea.
Bei Kauais Bevölkerung häufen sich Berichte über merkwürdige Krankheiten. Viele vermuten dahinter den massiven Pestizideinsatz der Biotechfirmen. Mütter erzählen von Kindern, die mit blutenden Nasen aus dem Schlaf aufwachen, junge Frauen von ungewöhnlichen Menstruationsbeschwerden, Männer von plötzlichen Anfällen von Erbrechen und Durchfall. Am schwersten aber wiegen die vielen Berichte über schlimme Geburtsfehler. Weil das entsprechende Register seit 2005 nicht mehr geführt wird, verabreden wir uns mit Jim Raelson, früher Kinderarzt im Spital gleich gegenüber der Waimea-Canyon-Schule, heute führt er seine eigene Praxis. Auf dem Rasen vor dem Spital stolziert ein besonders schöner Gockel mit glänzenden, schwarzen Federn. Frei herumlaufende Hühner sind auf Kauai überall anzutreffen, sie sind wie andere Wildvögel gesetzlich geschützt.
Jim Raelson hatte sofort Syngenta und Co. im Verdacht, als er feststellte, dass etwas nicht stimmte. Er spricht mit einem Bass, sein dicker Bart ist weiss, und seine Hände sind im Schoss gefaltet. «Besonders besorgniserregend ist die hohe Anzahl von sehr komplexen, sehr seltenen Herzdefekten bei der Geburt, die eine Notfalloperation in Los Angeles oder San Diego erfordert.» Eine dieser Krankheiten: eine Vertauschung der Lungen- mit der Hauptschlagader. Diese und drei weitere seltene und schwerwiegende Herzdefekte sind ohne Operation tödlich. «Als Kinderarzt in einer kleinen, ländlichen Region sollte ich nicht mehr als einen solcher Defekte alle zehn Jahre sehen. Aber ich hatte bereits drei Fälle, dann vier. Jedes Mal dachte ich: Was, schon wieder einer?» Alleine in den letzten drei Jahren zählte Raelson zehnmal mehr Fälle der vier tödlichen Herzdefekte bei Neugeborenen, als sie im landesweiten Durchschnitt vorkommen.
Im Krankenhaus war Streit ausgebrochen, als ein ehemaliger Anwalt eines Syngenta-Konkurrenten die Führung übernahm. Dieser ehemalige Anwalt ist nun der Chef der Kinderärztin Mika Snyder und zugleich der Grund, wieso sie ihren wahren Namen nicht nennen will. Sie befürchtet Strafmassnahmen, wenn sie sich öffentlich äussert, doch sie teilt Jim Raelsons Sorgen. Sie begann, eine Liste mit überdurchschnittlich oft auftretenden Geburtsfehlern zu führen: «Anomalien an den Ohren, Frühgeburten, Asthma, Nasenbluten, ADD, Autismus, Hufeisennieren, Klumpfüsse, Gastroschisis.» Bevor die Saatgut-Experimente starteten, waren diese Krankheiten auf Kauai unbekannt, heute kenne sie jeder, erzählt uns Alana, eine junge Mutter. Als die heute 29-Jährige vor fünf Jahren schwanger wurde, kam zuerst die gute Nachricht — ein Mädchen — dann die schlechte: Gastroschisis. Alana erklärt: «Die Bauchwand des Embryos war kaputt. Die Innereien befanden sich ausserhalb des Körpers in meinem Bauch.» Alana entschuldigt sich für ihre Tränen. «Wenn ich die Ultraschallbilder anschaute, sah es fast so aus, als würden Korallen um mein Baby schwimmen. Die Bauchwand des Mädchens war offen, und als es in mir heranwuchs, schlüpften immer mehr Dinge raus.»
Sidney Johnson ist ein Chirurg, der solche Fälle auf Oahu, der Hauptinsel des Archipels, behandelt. Hier, in Hawaiis grösstem Kinderspital, werden über die Hälfte der Geburten abgewickelt und alle komplexen Fälle wie Gastroschisis behandelt. Die Krankheitsursachen sind nicht vollständig erforscht. «Wir sind uns ziemlich sicher, dass Gastroschisis durch Umwelteinflüsse verursacht wird. Das können Fälle sein, in denen die Mutter raucht oder trinkt oder anderen Giften ausgesetzt ist. Mittlerweile werden aber auch andere Umweltgifte als mögliche Ursache für die Krankheit anerkannt.» Alana hatte nie geraucht, nie während der Schwangerschaft getrunken, sogar biologisch gegessen, sagt sie. Verschiedene Studien, die eine direkte Verbindung von Atrazin mit Gastroschisis herstellen, stiessen in Kauai natürlich auf besonderes Interesse; denn während Alanas Tochter mittlerweile fünf Jahre alt und gesund ist, liegen viele andere Neugeborene mit derselben Krankheit im Krankenhaus. Auch Johnson besitzt zwar keine genauen Zahlen, sagt aber, die Anzahl von Gastroschisis-Fällen sei im Vergleich zu seinem früheren Arbeitsort Boston «unerwartet hoch»; sie sei unter anderem verursacht durch Umweltgifte wie Pestizide, glaubt Johnson. Er wagt eine Schätzung: fünfzig Fälle pro 10 000 Geburten. Das sind über zehnmal mehr als im Rest der USA: Die Statistik der zuständigen US-Behörde weist bloss 4,5 Fälle auf 10 000 Geburten aus.
Diese und ähnliche Berichte verbreiteten sich auf der Insel rasch und verliehen Gary Hoosers Bewegung Aufschwung. Er erlangte eine knappe Mehrheit im Gemeinderat für ein neues Gesetz mit dem Namen «Das Recht zu wissen». Dieses sah vor, Syngenta und die anderen Saat-Konzerne zur detaillierten Bekanntgabe aller Sprühaktivitäten zu zwingen und sie zu verpflichten, bei ihren Sprühaktivitäten mindestens 150 Meter Abstand zu Schulen, Strassen und Residenzen zu halten. Die Reaktionen auf die Vorlage waren gewaltig. Bei öffentlichen Anhörungen im Sommer 2013 stellten sich Hunderte vor dem Gemeinderatsgebäude in Kauais Hauptstadt an. Jeder wollte seine Meinung kundtun. Irgendwann mussten die Anhörungen in einen grösseren Raum verlegt, die Polizei für Eingangskontrollen und Taschendurchsuchungen eingesetzt werden. Es erschienen Anwälte der Saatgutfirmen, auch deren lokale Mitarbeiter, doch die Unterstützer des neuen Gesetzes schienen die Oberhand zu behalten.
An einem Protestmarsch mit 4000 Teilnehmern im September desselben Jahres erschien einer als Teufel verkleidet, mit einer schwarzen Robe und einer feuerroten Maske mit der Aufschrift GMO (genetically modified organism). Die Demonstranten trugen fast alle rote T-Shirts mit der Aufschrift Pass the Bill («Verabschiedet das Gesetz»). Es waren die grössten Proteste, die auf der Insel je stattgefunden haben. Einen Monat später gab es die letzte und längste Anhörung, sie dauerte über 18 Stunden. Um 3 Uhr 30 in der Nacht verabschiedete der Rat das Gesetz.
Es ist stockdunkel, und wir überqueren eine kleine Brücke, fahren durch einen dichten Wald und biegen schliesslich zur letzten Wahlparty des heutigen Abends ab. Der Syngenta-Angestellte Arthur Brun kandidiert ebenfalls für den Gemeinderat. Den Ort kann man leicht übersehen: eine einfache Holzhütte mit einem heruntergekommenen Partyraum. Hier gibt es für Arthur Bruns rund 30 Anhänger Bier aus der Kühlbox und chinesische Fertiggerichte aus Alu-Containern. Es ist ein Fest für die Westseite der Insel, die vor der Ankunft der Saatgutfirmen völlig verarmt war und nicht nur optisch meilenweit entfernt ist von den Millionärsvillen im Norden und den Touristenanlagen im Süden der Insel. Auf der Holzterrasse und dem Kiesplatz wird geraucht, drinnen rauscht ein altes Radio, in dem jetzt der Sprecher die neuesten Wahlresultate verkündet. Der aktuelle Stand für den 7-köpfigen Gemeinderat: «Auf Platz sechs: Arthur Brun.» Carmelita, eine Arbeitskollegin und Wahlhelferin Bruns, springt aus dem Stuhl und klatscht. Brun verdrückt ein paar Freudentränen. Er ist ein grosser Mann mit einem dicken, dunklen Bart. Es sieht gut aus für ihn. Viel besser als erwartet. Nur noch eine einzige Auszählung steht an. Seinen Bossen dürfte es mehr als recht sein, wenn er es in den Gemeinderat schafft.
Es war auch Mark Phillipson zu verdanken, dass Brun auf die Liste von Syngentas Wahlempfehlungen gesetzt wurde. Mark Phillipson ist Top-Manager bei Syngenta und in Kauai das Gesicht der Industrie. Unter seiner Führung war erstmals eine solche Liste entstanden. Er fährt uns an einem Tag nach der Wahl durch Oahu, Hawaiis Hauptinsel, zum Verteilzentrum von Syngenta. Eigentlich wollte der ehemalige Pharma-Manager in Rente gehen, als ihm Syngenta einen Job anbot. Die Welt hat Hunger. Die Nachfrage nach genetisch optimiertem Saatgut wächst und mit ihm Syngentas Präsenz auf der Pazifikinsel. Rund 12 500 Pfund Saat werden jedes Jahr aufs US-Festland und in die Welt geschifft. Viermal mehr als noch vor wenigen Jahren. Der Marktwert der Industrie in Hawaii ist seit dem Jahr 2000 um 550 Prozent gewachsen. Auch Phillipson stieg schnell auf. Er war bald nicht mehr bloss einer der wichtigsten Manager Syngentas, sondern auch Präsident der Lobby-Gruppierung der Industrie, der Hawaiian Crop Improvement Association. Mitglieder sind neben Syngenta Monsanto, Dow, Pioneer und BASF.
Wir biegen vom Highway ab, der schwarze SUV holpert über eine Landstrasse, vorbei an brachliegenden braunen Feldern, am Horizont grüne Hügel. Phillipson lässt die Fenster runter. «Da oben siehst du die rote Vulkanerde im Kontrast mit den frischen, grünen Guinea-Gräsern. Dazwischen siehst du die Farmen. Die gelben Blumenwiesen sind Sonnenhanf.» Phillipson parkt den SUV vor einem weissen Container, «unsere brandneue Station, hier kopieren wir die Produkte, sobald sie für den Markt zugelassen werden.» Phillipson sieht aus wie der jüngere Bruder von Papst Ratzinger. Seine Augen liegen in tiefen Höhlen, seine Haut ist gräulich, seine Haare weiss. Eine markante, tiefe und rundlich geschwungene Denkfalte zieht sich von seiner Nase auf die rechte Hälfte seiner Stirn. Er trägt gerne Hawaii-Hemden und Jeans. Die Vorfälle von Waimea sind für ihn nicht der Rede wert, schliesslich entlaste der offizielle Bericht Syngenta. Bezüglich der «schrecklichen» Geburtskrankheiten weist er die Verantwortung von sich. «Ich bin ein datengetriebener Mensch. Wir haben 7000 Studien, die zeigen, dass Atrazin sicher ist. Ich muss mich auf diese Daten verlassen können!» Phillipson wird fast trotzig, wenn er über seine Gegner spricht. «Ich kann doch keine Debatte mit Menschen führen, die Wissenschaft nicht verstehen.» Wie die Gentech-Gegner glaubt er sich auf einer Mission von globaler Wichtigkeit — und zitiert Zahlen der Uno. Wie die Bevölkerung bis 2050 auf neun Milliarden anwachsen werde, sich der Nahrungsbedarf bis dahin verdoppeln dürfte. Er spricht von den Unruhen in Nahost. Er hält sie für «Nahrungskriege».
«Wir können in Kauai drei-, manchmal viermal im Jahr ernten. In Iowa pflanzen wir im Mai, ernten im September und warten ein Jahr lang.» Wenn Forscher auf dem Festland eine neue Sorte entwickelt haben, wird sie hier getestet. «Die pflanzen sie einmal in einem Treibhaus und schicken uns anschliessend die Samen hierher auf die Insel», sagt Phillipson.
Das hat die Erforschung neuer Pflanzen um fast die Hälfte der Zeit verkürzt: Statt rund zwölf Jahre dauert es dank der vielen Ernteperioden in Hawaii nur sechs Jahre, bis ein Produkt Marktreife erlangt. «Es kostet etwa 140 Millionen Dollar, eine neue Sorte auf den Markt zu bringen», sagt Phillipson. Wie gross die Ersparnisse genau sind, verraten die Firmen nicht. Ersparnisse, die von Gary Hooser und seinem Gesetz bedroht wurden. «Zwei Mitglieder des Gemeinderates kamen auf mich zu und sagten mir, dass diese Bewegung abhebt», erinnert sich Mark Phillipson. Er rief die Syngenta-Mitarbeiter zu monatlichen Treffen in Town Halls zusammen. «Das war der Start unserer Grassroots-Kampagne.»
Carmelita, Mitarbeiterin bei Syngenta und Kollegin von Gemeinderatskandidat Arthur Brun, eine kleine, stämmige Frau mit lederner, dunkler Haut, sass an diesen Anlässen in der vordersten Reihe und erinnert sich: «Wir werden kämpfen», sagte Mark Phillipson auf der Bühne der Town Halls. Kritiker warfen Syngenta später vor, dass die Firma ihren Mitarbeitern zu diesen Anlässen Angst eingejagt habe, um sie für den politischen Kampf zu gewinnen. Mark Phillipson bestreitet das. Doch ob gewollt oder nicht — die Arbeiter seien völlig eingeschüchtert gewesen und sicher, dass sie ihre Jobs verlören, wenn das Gesetz angenommen würde, erzählt Carmelita. «Ich habe die blanke Angst in ihren Augen gesehen.» An den Town Halls sprachen laut Carmelita Experten, aber auch Politiker hielten Reden, sogar Bürgermeister Carvalho sei gekommen, behauptet Carmelita, was dieser wiederum bestreitet. Nach den ersten dieser Town Hall Meetings tauchten in der Hauptstadt Līhuʼe auch Befürworter der Biotech-Firmen auf, viele von ihnen Syngenta-Mitarbeiter wie Carmelita. Syngenta liess sie in firmeneigenen Trucks in die Stadt fahren, gab ihnen blaue T-Shirts und kreierte damit eine Gegenbewegung zu Gary Hoosers rot gekleideten Aktivisten. Carmelita versteht die Befürworter des Gesetzes noch heute nicht. Es werde doch niemand krank hier! «Wir haben ja Mütter, die bei uns arbeiten, und die haben Kinder. Die Kinder sind völlig normal, die sind alle gesund.» Sie selbst seien es auch. Dann überlegt sie kurz und sagt, dass sie auf den Feldern manchmal Kopfschmerzen bekomme, rasende Kopfschmerzen. Manchmal müsse sie erbrechen. «Das ist eben das Stinkkraut. Es ist fürchterlich.»
Wir verlassen Bruns Party kurz vor der Bekanntgabe der letzten Resultate. Der Wahlabend neigt sich dem Finale zu, es fehlen lediglich noch die Stimmen aus dem Norden, der Bastion der Gegner der Saatgutfirmen. Diese könnten Arthur Brun gefährlich werden. Der Einzige, der jetzt schon zu den Gewinnern gehört, ist Carvalho. Kein anderer Politiker wird in Kauai von den Saatgutfirmen mehr umgarnt. Syngenta vertraute nicht alleine auf die Grassroots-Kampagne. Vor Gericht führte Syngenta eine Klage im Namen aller Biotech-Firmen auf Kauai an und gewann — es sei nicht Sache der Gemeinde, derartige Entscheidungen zu treffen, sondern Sache des Bundesstaates. Dieses Urteil wird derzeit angefochten. Im Kampf um die öffentliche Meinung startete Syngenta zudem eine Werbekampagne unter dem Titel Rettet Kauais Farmen und erhöhte die Lobbyausgaben um mehr als das Doppelte. Dazu kamen Wahlspenden an Politiker: Insgesamt 530 000 Dollar verteilten Syngenta und Co., deren Lobbyisten und den Firmen nahestehende Landbesitzer in Hawaii gemäss Statistiken des Wahlamtes in den letzten vier Jahren. Die Spenden stammen von Organisationen wie der Lobbygruppe CropLife, dem Council for Biotechnology Information, dem Hawaii Science & Technology Council — alles Organisationen, bei denen Syngenta und die anderen Saatgutfirmen Hawaiis Mitglied sind. Das Unternehmen gibt dies offen zu: Syngenta spende an Kandidaten, die ihre Ansichten teilen, schrieb Syngenta-Sprecherin LaScalea in einer Stellungnahme. Einer der neuen Wahlkampffonds, ein sogenannter SuperPAC, wurde mit rund acht Millionen Dollar gefördert, um Vorlagen wie die in Kauai in anderen Gemeinden Hawaiis zu bekämpfen. Die Profiteure waren oft dieselben: die Mitglieder des Parlaments und Neil Abercrombie, der Gouverneur Hawaiis.
Beim Streit um Hoosers Gesetz war nebenbei herausgekommen, dass die Saatgutfirmen offenbar versäumt hatten, Steuern für Pachtland an die Gemeinde zu bezahlen. Eine erste Untersuchung deckte Versäumnisse von über einer Million Dollar auf. Wohl nur die Spitze des Eisberges, waren doch bloss wenige kleine Flächen des von den Firmen gepachteten Landes untersucht worden. Ein bedauerlicher Fehler sei das, sagten uns Clarence Nishihara, Senator und damals Vorsitzender des Agrikultur- Komitees, Jimmy Nakatani, Chef der Agribusiness Development Corporation und Syngenta-Manager Mark Phillipson, ohne jedoch konkrete Pläne vorzulegen, wie der Fehler behoben werden soll. Später lehnte Syngenta eine Stellungnahme dazu gänzlich ab. Auch im Kampf gegen das neue Gesetz selbst schlug sich der Staat zusammen mit Carvalho auf die Seite der Saatgutfirmen und torpedierte es mit hastig eingeführten neuen Initiativen. Clarence Nishihara, Vorsitzender des Agrikultur- Komitees im Staat Hawaii, forderte so eine Regelung, wonach den Gemeinden Hawaiis jegliche Macht zur Regulierung von Farmern — und damit der der Saatgutfirmen — genommen werden sollte. Doch zu diesem Zeitpunkt war die Öffentlichkeit bereits aufmerksam, die Vorlagen scheiterten. Also rief Carvalho den Gouverneur Abercrombie zu Hilfe, der daraufhin dafür sorgte, dass dem neuen Gesetz in Kauai die Schlagkraft genommen wurde: Abercrombie präsentierte das «Good Neighbor Program», in dem in Partnerschaft mit den Saatgutfirmen Zahlen zur Nutzung von Pestiziden veröffentlicht werden sollten — freiwillig. Hoosers Gesetz hätte die Firmen dazu verpflichtet.
Kurz darauf gab Carvalho zwei Lobbyisten den Job, auf Bundesstaatsebene für die Interessen der Gemeinde zu kämpfen. Zuvor hatten beide für Syngenta gearbeitet: Der Job war der gleiche. Die Aktivisten tobten. Doch für Carvalho war der Weg geebnet, um das Gesetz mit einem seiner stärksten Mittel anzugreifen: dem ersten Veto seiner Karriere. Jetzt stellten die Aktivisten den Bürgermeister zur Rede.
Nur einen Katzensprung vom Ort seiner heutigen Wahlparty entfernt schritt Carvalho vor Jahresfrist die Treppe von seinem Büro in den runden Innenhof des majestätischen Regierungssitzes hinunter. «Sie haben es wieder getan!», schrie ein wütender Bürger. Wieder hatte sich die Politik auf die Seite der Saatgutfirmen geschlagen. Eine Menge hatte sich versammelt. Buh-Rufe erfüllten den Innenhof. Auch der Teufel in der schwarzen Robe und der GMO-Maske war gekommen. «Lasst uns reden», rief der Bürgermeister. «Mir tut es wirklich leid», versuchte Carvalho zu sagen. «Nein, tut es dir nicht», unterbrach ihn einer der aufgebrachten Bürger. Carvalho streckte beide Arme von sich und bat um Ruhe. «Lasst uns reden!», rief er immer wieder. «Du bist im Sack der Konzerne!» — «Ihr könnt euch lustig machen, ihr könnt mich nennen, wie immer ihr wollt. Ich bin mit euch marschiert. Ich habe stundenlangen Diskussionen zugehört. Ich habe mit der Wissenschaftsseite geredet, ich …» Die Masse wurde unruhiger, rief immer wieder dazwischen. Einige hielten ihre Smartphones in die Höhe wie Waffen, bis heute dokumentiert ein Youtube-Video die Szene: «Ich habe mit den Ärzten gesprochen», sagte Carvalho. Einer der Zuhörer lachte. «Ich habe es vor allem mit meinem Herzen und meiner Seele angeschaut.» Jetzt prustete einer, direkt neben dem Bürgermeister, worauf sich dieser wutentbrannt umdrehte: «Ich bin ein Bewohner dieser Insel!» Und schreiend: «Geboren und aufgewachsen hier!» Carvalho verlor nur kurz die Fassung. Er betonte, dass er mit dem Gesetz einverstanden sei, aber dass es doch rechtliche Schwächen aufweise und für die Gemeinde zu gross sei. Dass er aber dasselbe wolle wie sie. «Shibai», sagte eine leise Stimme. Hawaiianisch für einen, der doppelzüngig redet, etwas vorspielt. «Shibai!», riefen andere nun lauter. «Das Gesetz war unsere einzige Hoffnung. Und du hast alles zerstört!», rief jemand. Es wurde augenblicklich still. Hina, eine Mutter aus Waimea, eine junge, kleine Frau, lange schwarze Haare, runde Figur, trat näher an den Bürgermeister heran. «Wie lange noch müssen meine Kinder leiden? Meine Neffen und Nichten wachen nachts mit Blut auf ihren Kissen auf. Mein Sohn hat Anfälle. Wir haben ein kleines Mädchen auf der Westseite, dem gerade Krebs diagnostiziert wurde.» Sie zitterte und wischte sich mit ihrem Hemd die Tränen aus dem Gesicht. «Wie lange noch?»
Das alles ist nun fast genau ein Jahr her. Die Shibai-Rufe sind nur noch eine weit entfernte Erinnerung. Heute Abend schwingt Carvalho seine Hüften zu Twisting the Night Away und feiert seinen Wahlsieg: Er ist mit riesigem Vorsprung wiedergewählt worden. Doch der wahre Sieger heisst Syngenta. Die letzten, aus dem Norden eintreffenden Stimmen haben am Endresultat nicht mehr viel geändert. Gary Hooser hat es zwar noch in den Rat geschafft, im Gegensatz zu Syngenta-Mann Arthur Brun. Carvalho steht jetzt ein Gemeinderat zur Seite, in dem die Unterstützer der Saatgutfirmen die neue Mehrheit bilden. 4:3 zugunsten der Biotech-Industrie. Der Fotograf schiesst die ersten Bilder. Carvalho hat auch als Bürgermeister noch die Figur des Football-Spielers, der er in der Schule war. Gross, breite Schultern, jetzt bloss mit ein paar zusätzlichen Kilos auf den Hüften. Vor lauter Aufregung wirkt er wie ein Kind. Carvalho, im feinen, türkisfarbenen Hemd und mit einem übergrossen Kranz gelber Blumen um den Hals, bückt sich zu seinem Vater, der verlegen lächelt. Das Bild wird am nächsten Tag auf der Frontseite der lokalen Zeitung unter den Worten «Carvalho gewinnt» zu sehen sein. «Die wollten den Topf aufmischen. Und ich mag das nicht», diktiert Carvalho mit durchgestrecktem Rücken einem Journalisten ins Aufnahmegerät. «Das darf nicht sein auf Hawaii. Der Geist von Aloha erfreut sich bester Gesundheit!»
Die Schweizer Reporter Michaël Jarjour (Jahrgang 1984) und Julie Zaugg (1979) interessieren sich für Wirtschaft, Politik und seltsame Menschen. Beide leben und arbeiten in den USA.
Mehr zum Thema Landwirtschaft finden Sie in Reportagen #5, AML. 230849-012-G, Afrika kaufen oder 200% Bio (#14).