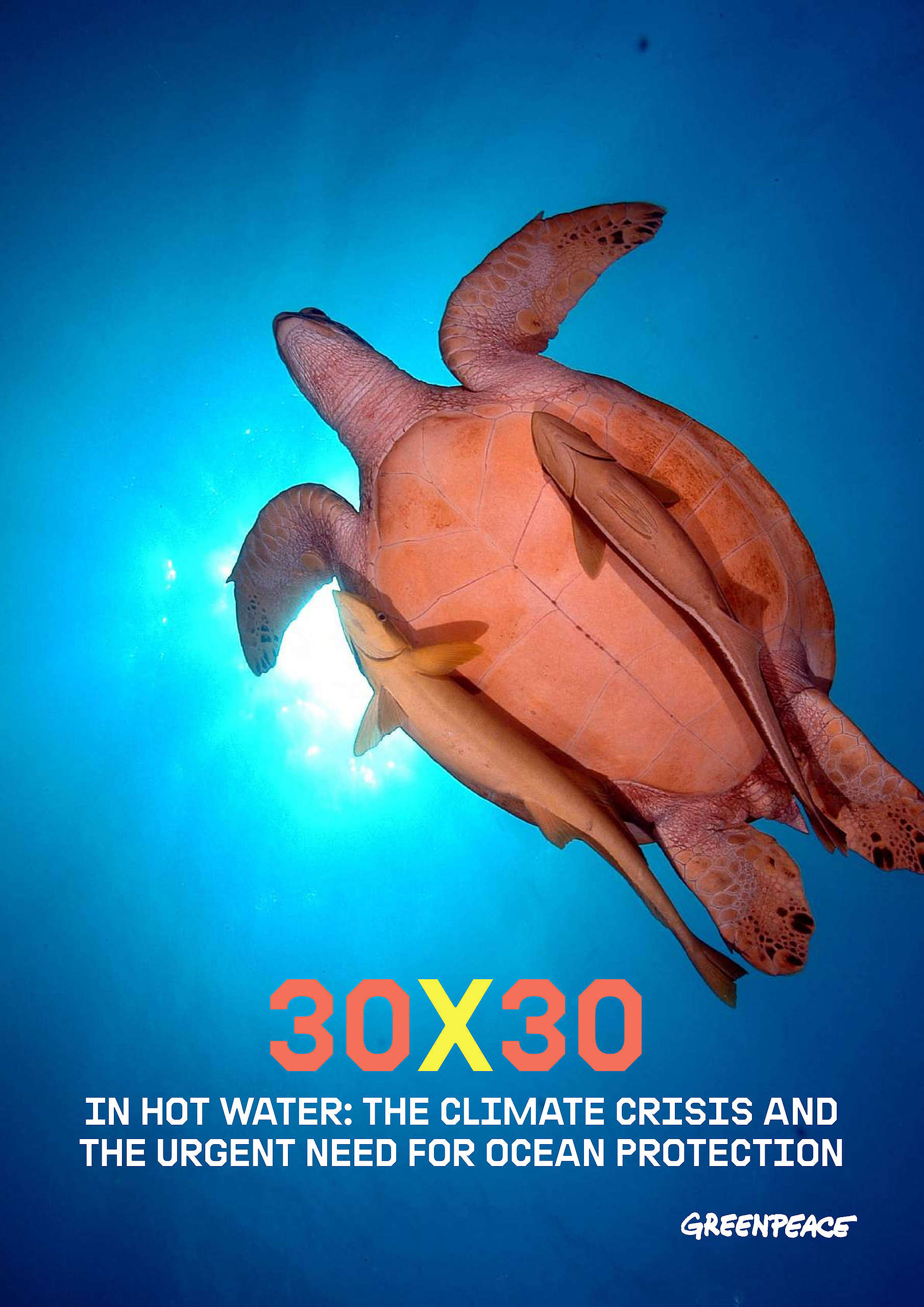Zwischen Selbstverwirklichung, Sinnessuche und Sozialen Medien. Irgendwo unter all den Smartphones, Smart-TVs und Smartwatches begraben. Genau da setzt sich Greenpeace-Praktikantin Danielle mit den Hoffnungen, Herausforderungen und Problemen ihrer Generation Y auseinander – und fragt sich in ihren kommenden Kolumnen: Wie zum Teufel soll das grün gehen?
«Free Willy» – Wer kennt den Film schon nicht? Ich war etwa acht Jahre alt, als ich ihn Zuhause zum ersten Mal auf VHS-Kassette (welch Nostalgie) sah – und seither mindestens zehn weitere Male. Ich erinnere mich genau daran, wie faszinierend ich den kleinen Jungen Jesse fand, den eine tiefe Freundschaft mit dem Orca Willy verband. Und an den gutherzigen Indianer Randolph, mit dessen Hilfe Jesse den Wal am Ende des Films aus der Gefangenschaft befreit – mit diesem unvergesslichen Sprung über die Felsen! Dazu noch die Musik von Michael Jackson: «Will you be there». Gänsehaut pur.
Der Film hätte mich damals wohl eines lehren sollen: dass Tiere nicht in Gefangenschaft gehören. Doch wie es bei Kindern halt so ist, steht die Unterhaltung im Vordergrund. Die Message dahinter begreift man erst Jahre später. Und so ging auch ich in meiner Kindheit auf die Suche nach Kaulquappen, die ich Zuhause in einem mit Wasser gefüllten Tupperware zu kleinen Fröschen züchtete. Oder holte Raupen aus dem Wald, um sie in einer mit Luftlöchern versehenen Schuhschachtel zu füttern. Und wie jedes Kind ging auch ich mit meinen Grosseltern in den Zoo. Unzählige Male. Erst heute ist mir bewusst, wie falsch das war.

Meinen Grosseltern kann ich die Zoo-Besuche gar nicht vorwerfen. Erstens, weil sie meine Grosseltern sind. Zweitens, weil sie es ja gar nicht anders kannten, bzw. sie es nicht besser wussten. Denn ihnen allen wurden Zoos von der Gesellschaft als etwas Wunderbares verkauft – genau wie das Rauchen. Sie galten als eine Institution, die den Naturschutz gewährleistete und das Erforschen neuer Erkenntnisse im Tierbereich ermöglichte. Und vor allem als etwas, was den Enkelkindern Spass machte – auch heute ist das noch so.
Wir Schweizer drücken uns also seit Jahrzehnten die Nasen an den Scheiben platt. Der älteste Zoo unseres Landes, der «Basler Zolli», wurde bereits 1874 eröffnet. Er musste zur damaligen Zeit in der Schweiz wohl so etwas wie eine Sensation gewesen sein. Als ich das letzte Mal – vor ca. fünf Jahren – hindurch spazierte und die Tiere in ihren viel zu kleinen Gehegen sah, empfand ich ihn vor allem als eines: sensationell grauenhaft.

Seitdem frage ich mich: Wie können wir solche Institutionen heute noch zulassen? Wir haben doch gerade in unserem Zeitalter so viel Zugang zu Material, welches uns eines Besseren belehren sollte. Netflix-Dokumentationen wie «Blackfish» beispielsweise: Diese gewährt einen Einblick in das grausame Leben von Orcas in Sea Worlds in den USA – und was die Gefangenschaft für schlimme Auswirkungen auf deren Wesen hat. Oder unzählige Videos auf Facebook, die zeigen, wie Löwen im Zirkus offensichtlich frustriert auf ihre Dompteure losgehen oder Tiger im Zoo fast schon dumpf von einem Ende des Geheges zum anderen gehen. Wir haben heutzutage sogar die Möglichkeit, im Internet schnell ein Flugticket zu kaufen, um die Welt zu reisen und die Tiere selber in freier Wildbahn zu beobachten – etwas, wovon unsere Grosseltern nur träumen konnten.
Paradoxerweise verfestigt sich das alles nicht in unserem Bewusstsein, sondern landet wieder dort, wo es her kam: Im Internet. Auf Twitter erzählen wir unseren Followern von den spannenden Dokus, die wir gesehen haben. Auf Facebook teilen wir das schockierende Video, natürlich mit einem bestürzten Smiley betitelt. Auf Instagram posten wir die Bilder unserer Safari in Südafrika, versehen mit Hashtags wie #AmazingWildlife und #LoveNature. Und im echten Leben? Die Antwort auf diese Frage liefern die jüngsten Ereignisse im Zoo Basel gleich selber: 2024 soll ein Ozeanium realisiert werden. Obwohl wir durch die heutige Technologie so gut wie nie zuvor über das Leiden der Tiere in Gefangenschaft informiert sind und in den Sozialen Medien so besorgt um das Wohl der Tiere zu sein scheinen, lassen wir es zu, dass Fische aus dem Meer geholt und in einen riesigen Tank geworfen werden. Dies alles, damit Besucher unter anderem Fotos fürs Familienalbum namens Facebook schiessen können – #Tierquälerei.
Laut dem Zoo Basel ist alles natürlich nur halb so wild, wie er auf seiner Webseite verlauten lässt: «Der Zoo wird selbstverständlich keine Tiere im Ozeanium halten, die für die Aquarienhaltung nicht geeignet sind.» Für einige mag dies beruhigend klingen, für mich definitiv nicht. Denn worauf basiert ihr Wissen darüber, welche Tiere für Aquarien geeignet sind? Genau, auf Forschungen und Statistiken, die alle eines gemeinsam haben: Sie wurden von Menschen erstellt. Tiere haben in solchen Entscheidungen kein Wort zu sagen. Was ja logisch ist, denn das Leben ist kein «Dr. Doolittle»-Film, in welchem die Tiere sprechen können. Leider.
Wenn sie es könnten, wäre wohl eines schnell klar: Tiere brauchen uns nicht – auch wenn dies gerne behauptet wird. Beispielsweise auf der Webseite von Schweiz Tourismus, welche in der Beschreibung des Sea Lifes in Konstanz erwähnt, dass die Fische in dessen Aquarium «gerettet wurden und nicht in den natürlichen Lebensraum zurückgeführt werden können». In Einzelfällen mag dies ja stimmen. Betreffend die Massen, in welchen man die Meerestiere in den Aquarien aber vorfindet, scheint diese Behauptung eher fadenscheinig.
Der Mensch hingegen – er braucht das Tier. Nur alleine, um den eigenen Wohlstand zu sichern. Denn hinter allem, was der Mensch mit Tieren anstellt, steht immer eines: Geld. Das bewies vor kurzem abermals der Beschluss der Antarktis-Konferenz, den Antarktischen Ozean vor der Fischerei nicht zu schützen. Wieder einmal mehr war das wirtschaftliche Interesse wichtiger als das Wohl der Tiere. Anstatt uns also darum zu kümmern, dass Tiere nicht mehr eingesperrt werden, zerstören wir Schritt für Schritt auch noch ihren natürlichen Lebensraum. Anstatt uns an «Free Willy» ein Beispiel zu nehmen, landen immer wieder aufs Neue Meeresbewohner in Sea Worlds, Aquarien oder eben einem Ozeanium. Und anstatt in der Realität etwas für die Tiere zu tun, schenken wir ihnen die Aufmerksamkeit lediglich in der virtuellen Welt.
Was würden wohl Jesse und Randolph dazu sagen?
Danielle Müller studierte Journalismus und Unternehmenskommunikation in Berlin und schnuppert nun bei Greenpeace rein. Die 27-Jährige Baslerin ist stets im Sattel ihres Rennvelos anzutreffen und sagt nie Nein zu einer guten Umwelt-Doku auf Netflix.
Wenn du für die Lebewesen der Antarktis spenden möchtest, kannst du das hier. Oder informiere dich hier bei OceanCare über Petitionen, mit welchen du dich für Ozeane und Meeressäuger einsetzen kannst.