Noch nie gab es so viele und so gute Umweltgesetze wie heute. Aber Unternehmen, Behörden und Politiker finden viele Wege, sie zu umgehen, zu verzögern oder zu verwässern.
Die Regel ist klar und deutlich: In Schweizer Flüssen und Bächen dürfen nicht mehr als 0,1 Mikrogramm Pestizidrückstände pro Liter Wasser auftauchen. So schreibt es die Gewässerschutzverordnung vor. Ebenso klar und deutlich ist aber auch, dass diese Vorschrift nicht eingehalten wird: In 78 Prozent der Fälle lag die Giftkonzentration über diesem Wert, befand 2014 eine umfangreiche Studie des Wasserforschungs-instituts Eawag. Der vom Bundesrat initiierte «Aktionsplan zur Risikoreduktion und nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln» macht den Gesetzesbruch gar zum Zukunftsmodell: Bis 2026 soll der Grenzwert nur noch in der Hälfte der Flussabschnitte überschritten werden. «Wir werden also das Gesetz nur noch halb so oft brechen», konstatiert Greenpeace-Landwirtschaftsexperte Philippe Schenkel trocken.
Die Schweiz ist kein Sonderfall. In Europa und in der ganzen Welt werden Umweltgesetze in grossem Stil jeden Tag umgangen und ge-brochen. Wenn der Schutz von Mensch und Natur die Gewinne von Unternehmen bedroht, wenn er die industrielle Landwirtschaft gefährdet, den internationalen Handel einschränkt oder der Politik harte Entscheidungen abverlangt, werden Behörden, Manager und Politikerinnen kreativ. Die Normen werden verwässert, ausgesetzt, durch Schlupflöcher entwertet oder schlicht ignoriert. «Weltweit haben wir derzeit die besten Umweltregeln, die es in der Geschichte der Menschheit jemals gab», sagt John Pendergrass vom Institut für Umweltrecht (ELI) in Washington. «Aber es gibt noch eine Menge Raum für Verbesserungen.
Millionenbetrug der Autohersteller
Die brutalste Form, Umweltgesetze zu umgehen, demonstriert seit 2015 der VW-Konzern. Weil die Dieselmotoren seiner Autos die Grenzwerte für Stickoxid weit überschritten und die Abgasreinigung teuer war, täuschten die Ingenieure in Wolfsburg bei den regelmässigen Prüfungen mit einer geheimen Software saubere Abgase vor. Erst Recherchen von Umweltgruppen und der US-Umweltbehörde EPA wiesen dem grössten Autokonzern der Welt nach, wie dreist er die Gesetze zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt gebrochen hat. Allein durch Dieselgate sind in den USA 60 Menschen zusätzlich an Schadstoffen aus Auspufftöpfen gestorben, zeigt eine Studie. Nun droht VW in den USA eine Strafe von 15 Milliarden Dollar. In Europa allerdings nicht. Es werde keinen vergleichbaren Schadenersatz geben, erklärte VW-Chef Matthias Müller. Millionenfacher Betrug, die Belastung der Umwelt und die Gefährdung der Gesundheit werden hier kaum geahndet.
VW ist nicht allein mit Dieselgate. Die meisten Autohersteller verschleiern ihre Schadstoffwerte, den wahren Verbrauch von Treibstoff und die wahren klimaschädlichen CO2-Emissionen – oft mit Wissen und Zustimmung der Behörden. Der Diesel-Skandal zeigt, wie schnell und einfach Umweltnormen, Selbstverpflichtungen und staatliche Kontrolle in Rauch aufgehen. Oft sind deshalb Umweltgesetze das Recyclingpapier nicht wert, auf dem sie geschrieben sind.
Viele Ökonormen haben schwere Geburtsfehler: Ziele und Massnahmen sind schwammig; es ist unklar, wer klagen kann. Und wenn es zu einer Klage kommt, werden die Normen von Anwälten zerpflückt. Felix Ekardt, Professor an der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik der Uni Rostock, nennt es ein «Grund-element von Umweltrecht und Umweltpolitik, dass weitreichende Ziele festgelegt werden, die dann in mittelmässige oder ungeeignete Instrumente übersetzt werden, die durch Ausnahmen dann noch weiter durch-löchert werden». Umweltgesetze definierten gern «symbolträchtig die grossen Ziele, wie die Welt zu retten ist, sind aber inhaltlich oft lasch», sagt Jurist Ekardt. Konkurrierende Regeln zur Förderung der Wirtschaft seien dagegen meist «sehr konkret und deshalb leicht umzusetzen».
Dazu kommt: Da Flüsse oder Wälder nicht vor Gericht erscheinen können, ist ihr juristischer Schutz eingeschränkt. In Deutschland etwa darf bislang niemand gegen eine behördliche Genehmigung oder für deren Vollzug klagen, der nicht in seinen Rechten direkt betroffen ist. In der Schweiz dagegen dürfen Ökoverbände auch klagen, wenn sie nicht direkt betroffen sind. In den Niederlanden haben die Gerichte sogar eigene Experten, die sich um ökologische Fragen kümmern.
Die Macht der Lobbyisten
Den Schutzgedanken eines Umweltgesetzes hebeln Interessengruppen oft schon früh aus. Vor allem die Lobbyisten von Bauern und Autoentwicklern, Stahlherstellern oder Kohlekraftwerkbetreibern schreiben bei den Entwürfen von Gesetzen und Verordnungen kräftig mit. So hat die deutsche Regierung mehrfach schärfere EU-Regeln zum Spritverbrauch von Kraftfahrzeugen verhindert oder verwässert und dabei die Positionen von Mercedes, Audi, BMW und Co. übernommen.
Ist eine Regel beschlossen, muss sie noch lange nicht umgesetzt werden – Umweltgesetze werden gern auf die lange Bank geschoben. So beauftragte die UN-Klimakonferenz von Kyoto 1997 die UN-Flugbehörde ICAO, einen Plan auszuarbeiten, wie die steigenden CO2-Emissionen aus dem rasant wachsenden internationalen Flugverkehr reduziert werden könnten. Die ICAO, in der vor allem Airlines und Fans des Luftverkehrs das Sagen haben, brauchte volle 19 Jahre, bis sie im Oktober 2016 ein Konzept dazu vorlegte: Das sogenannte CORSIA-System soll ab 2021 auf freiwilliger Basis die Länder dazu bringen, den Zuwachs der Emissionen durch Emissionszertifikate auszugleichen. Weil die Details unklar sind und das System erst 2027 verbindlich sein soll, hat die ICAO faktisch 30 Jahre ihren Auftrag zum Schutz der Atmosphäre ignoriert.
Ohnehin steckt auch bei Ökoregelungen der Teufel oft im Detail. Der Schutz leidet, wenn das Kleingedruckte nichts taugt. Der Deutsche Bundestag hat beispielsweise Gesetze und Verordnungen erlassen, die Wärmedämmung und Öko-Energien für Neubauten vorschreiben. «Das Baurecht sieht aber kaum Verfahren vor, in denen die Behörden prüfen könnten, ob diese Regeln in Wohnhäusern eingehalten werden», moniert der Jurist und Umweltfachexperte Felix Ekardt. Niemand weiss also, ob und wie die Regeln befolgt werden. Oder: Bei der CITES-Artenschutzkonferenz in Johannesburg im Oktober 2016 wurden Dutzende von Tier- und Pflanzenarten neu geschützt; vor allem wollen nun alle Staaten auch den nationalen Handel mit Elfenbein verbieten. Aber die entscheidende Frage, wie Korruption und Wilderei konkret bekämpft werden sollen, wurde nicht beantwortet.
Personalmangel verhindert Kontrollen
Das beste Gesetz wird umgangen, wenn es nicht kontrolliert wird. Ein Beispiel: Die EU hat 2010 endlich eine Verordnung erlassen, die illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei verhindern soll. Demnach müssen alle Einfuhren in die EU mit genauen Herkunftspapieren versehen sein. Eine «sehr fortschrittliche Regelung», wie der Umweltverband WWF lobt. Allerdings gestand die deutsche Regierung auf eine Anfrage der Linken-Fraktion ein, mangels Personal könnten nur 30 Prozent aller Unterlagen von den Sachbearbeitenden in deutschen Häfen geprüft werden – ein Grossteil der jährlich 370 000 Tonnen importierter Meerestiere landet also in den Kühltheken der Fischmärkte, ohne dass jemand weiss, ob sie von Piratenflotten aus dem Meer gestohlen wurden.
Die Regeln lassen sich nicht nur beim Import, sondern auch beim Export umgehen. Die Schweizer Rohstoffkonzerne Vitol und Trafigura haben nach einer Recherche der Menschenrechtsorganisation Public Eye schmutzigen Dieseltreibstoff nach Westafrika verschifft, weil dort die Umweltstandards niedriger sind. Der Bericht «Dirty Diesel» weist nach, dass diese Treibstoffe als «African Quality» in Europa gemischt und dabei die europäischen Werte bei Benzol, Schwefel oder den toxischen Kohlenwasserstoffen PAK bis zum 378-Fachen überschritten werden. Der Treibstoff, in Europa verboten, schädigt Luft und Lungen in afrikanischen Grossstädten. Die in der Schweiz lancierte Konzernverantwortungsinititative, initiiert von 80 Hilfswerken, Frauen-, Menschenrechts- und Umweltorganisationen, kirchlichen und gewerkschaftlichen Vereinigungen sowie Aktionärsverbänden, will diese Praxis nun stoppen.

Schwieriger Vollzug der EU-Umweltnormen
Es gebe gerade bei Behörden, Regierungen und Parlamenten ein «Umgehen von Umweltnormen durch Unterlassen», sagt die Anwältin Roda Verheyen. Mit Kollegen ihrer Kanzlei in Hamburg verhandelt sie immer wieder Fälle mit Bezug zu Umweltfragen. «Die Wasserrahmenrichtlinie der EU etwa verlangt, dass bis 2027 alle Gewässer in einen guten ökologischen Zustand zu bringen sind. Wenn ein Bundesland wie Hessen etwa bei der Werra und der Weser sagt, wir nehmen eine weniger strenge Qualität in Kauf, weil alles andere zu teuer wäre und die Arbeitsplätze in der Kali-Industrie gefährden würden, dann wird diese Norm umgangen», sagt Verheyen. Ausserdem führe auch das Sparen in Umweltprogrammen dazu, dass geltende Gesetze nicht angewandt werden könnten. So würden Naturgebiete nach der europäischen «Fauna-Flora-Habitat»-Richtlinie so verspätet ausgewiesen und bewirtschaftet, dass die EU nun Deutschland deswegen vor Gericht gebracht habe.
Immerhin soll die Öffentlichkeit ab 2017 im neuen «Umweltrechtsbehelfsgesetz» die Möglichkeit bekommen, den Behörden auf die Finger zu schauen. Dann können Umweltverbände auch Details einer bestehenden Genehmigung angreifen und die Verwaltung zum korrekten Vollzug ihrer eigenen Anordnung verpflichten lassen. «Das wird eine völlig neue Dimension des Rechtsschutzes für die Natur und die Menschen», meint Roda Verheyen. Allerdings habe der Fortschritt auch einen grossen Nachteil: Klagerecht hätten auch nach der neuen Regelung nur anerkannte Umweltverbände – in Deutschland damit faktisch nur der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), der Naturschutzbund (Nabu) und die Umwelthilfe (DUH). «Millionen von Menschen, etwa in Bürgerinitiativen, bleiben weiter von diesem Recht ausgeschlossen.»
Grössere Budgets, bessere Gesetze
Eine der wichtigsten Aufgaben sei, die Informationsflüsse zu verbessern, sagt John Pendergrass vom Washingtoner Institut für Umweltrecht ELI. In Ländern wie Indien etwa verstiessen viele kleine und mittlere Betriebe gegen Umweltgesetze, weil sie gar nicht von ihnen wüssten. Globale Konzerne seien oft besser informiert und bestrebt, die Gesetze ein-zuhalten, schon wegen möglicher Imageschäden. Mit politischem Willen sei vieles zum Besseren zu verändern, ist Pendergrass überzeugt. Global gebe es vor allem zwei Probleme: «Weil Umweltbehörden unterfinanziert sind, haben sie nicht genug Mitarbeitende für ihre Aufgaben. Zudem fehlt bei den meisten Umweltgesetzen ein umfassender Ansatz.» Mit grösseren Budgets und besseren Gesetzen sei folglich schon viel gewonnen.
Allerdings verkünden Regierungen und Parlamente gern grosse Ziele beim Schutz des Klimas, der Artenvielfalt oder des Bodens – und gefährden sie dann, indem sie viel Geld für das Gegenteil ausgeben. So subventionieren Länder, die das Pariser Abkommen zum Klimaschutz ratifiziert haben, gleichzeitig Kohle, Öl und Gas, die stärksten Treiber des Klimawandels, direkt mit jährlich knapp 500 Milliarden Dollar. Rechnet man die Schäden der fossilen Brennstoffe hoch, wie es eine Studie des Weltwährungsfonds IWF tut, kommt man sogar auf 5,3 Billionen Dollar jährlich – das wahre Preisschild von Kohle, Öl und Gas.
Dazu kommen direkte und indirekte Zahlungen für die industrialisierte Landwirtschaft. Allein in der EU machen diese Zahlungen mit jährlich etwa 60 Milliarden Euro einen grossen Teil des Haushalts aus. Aus dieser Landwirtschaft stammen nicht nur Brot, Milch und Wurst, sondern auch Schadstoffbelastungen von Luft, Böden und Gewässern, welche gegen EU-Grenzwerte verstossen und die staatlichen Ziele zur Artenvielfalt untergraben. Ausserdem unter-laufen staatliche Subventionen wie die Pendler-pauschale alle Regularien, um Böden zu schützen und sie vor der Versiegelung durch Strassen, Eigenheime und Shoppingcenter zu bewahren.
Auf der anderen Seite können die Steuerzahlenden zur Kasse gebeten werden, wenn ihre Regierungen etwas ökologisch Sinnvolles tun: 4,7 Milliarden Euro verlangt der schwedische Energie-Staatskonzern Vattenfall von der deutschen Regierung wegen des Atomausstiegs von 2011. Weil der Konzern seine Atomkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel an der Elbe nicht mehr betreiben konnte, klagte er auf Schadenersatz – und weil er kein deutsches Unternehmen ist, nutzt er dazu die «Energiecharta», die Investoren im Ausland schützt. Der Prozess läuft vor einem Sondergericht in Washington und erfüllt alle Befürchtungen, die Umweltschützerinnen und viele Bürger gegen die Regeln des Freihandels haben.
Freihandel oder Klimaschutz?
Eines der Hauptargumente gegen Freihandelsverträge der Europäischen Union wie TTIP mit den USA oder CETA mit Kanada ist die Angst, dass Umwelt- und Sozialstandards gegenüber dem Investorenschutz verlieren würden oder Firmen Regeln ganz verhindern. Die Befürworter des Freihandels weisen diese Befürchtungen weit von sich: Auf keinen Fall würden Ökostandards reduziert oder die Hoheit über die eigenen Gesetze aufgegeben. Doch die Europäer sind schon einmal eingeknickt: 2014 wollte die EU aus Gründen des Klimaschutzes in der «Treibstoffrichtlinie» alle importierten Treibstoffe danach sortieren, wie viel CO2 bei ihrer Verbrennung entsteht. Die Treibstoffe aus kanadischem Ölsand wurden von unabhängigen Gutachtern als besonders klimaschädlich gebrandmarkt. Doch der massive Druck der kanadischen Regierung und der Ölgesellschaften in Brüssel führte dazu, dass die EU die öffentliche Klassifizierung nach Klimaschädlichkeit wieder fallen liess – während zeitgleich die Verhandlungen der EU-Kommission mit der kanadischen Regierung über das Freihandelsabkommen CETA abgeschlossen wurden.
Deshalb gibt es grosse Bedenken bei den Umweltverbänden. Ernst-Christoph Stolper vom deutschen Bund für Umwelt und Naturschutz konstatiert, dass Freihandel und Klimaschutz «schon immer in einem Spannungsverhältnis standen». Konflikte sieht er vor allem beim Klimaschutz. Dafür müssten die erneuerbaren Energien gefördert werden und grosse Reserven an Gas, Öl und Kohle im Boden bleiben – was faktisch einer Enteignung der Energiekonzerne gleichkomme. Bei CETA seien Investitionen in Treibstoffe, Produktionsanlagen und fossile Infrastruktur jedoch «ohne Wenn und Aber geschützt und vor Schiedsgerichten einklagbar. Was, wenn wegen des nötigen Klimaschutzes irgendwann der Kohleausstieg beschlossen würde?», fragt Stolper. Würde dann der zuständige Staat wegen Schadenersatz vor Gericht gebracht, wie Deutschland gegenüber Vattenfall beim Atomausstieg? Die unbestimmten Begriffe «gerechte Behandlung» des Investors und «indirekte Enteignung» bilden nach wie vor die materielle Rechtsgrundlage der Verfahren vor dem Schiedsgericht.
Grundsätzlich seien Umwelt- und Handelsabkommen gleichwertig, sagt Felix Ekardt. Aber das Handelsregime setze sich durch sein System der Konfliktregelung immer wieder durch. Nur bei der Welthandelsorganisation WTO gibt es einen Gerichtshof und Sanktionen gegen Staaten, die Urteile nicht akzeptieren. Die Klimarahmenkonvention UNFCCC und das Pariser Abkommen zum Klimaschutz dagegen beruhen weitgehend auf Freiwilligkeit. Die Staaten haben genau darauf geachtet, dass sie keine juristischen Konsequenzen fürchten müssen, wenn sie die Umweltregeln missachten.
Gute Ideen werden torpediert
Tatsächlich arbeiten derzeit etwa 50 Staaten, darunter die EU, China, die USA und die Schweiz, an einem eigenen Freihandelsabkommen für Umweltgüter: Im «Environmental Goods Agreement» (EGA) sollen Produkte wie Windräder, Wasserfilter, Dampfturbinen, Bambusholz, Klimaanlagen, Fahrräder oder Pumpen von Zöllen ausgenommen werden, um weltweit grüne Technologien voranzubringen. Doch die gute Idee, einen global auf etwa eine Billion Dollar geschätzten Markt zu fördern und der Verbreitung von Ökotechnologien zu helfen, stösst auf Schwierigkeiten: Die Verhandlungen ziehen sich hin. Und viele Länder schielen mehr auf ihre Exportinteressen und den Schutz ihrer heimischen Produktion als auf die Rettung der Welt.
Ausdrücklich nicht gelöst vom EGA würde der wichtigste Streit beim Export von Umwelttechnologie: Dürfen Importstaaten über eigene ökologische und soziale Kriterien heimische Ökobetriebe bevorzugen? Solche «Local Content»-Regeln seien unzulässig, hat die WTO wiederholt geurteilt – und so etwa 2013 eine aufkeimende Solarindustrie in Kanada erstickt. Nur drei Monate nach dem Klimagipfel von Paris, auf dem Indien für sein ehrgeiziges Programm zum Ausbau der heimischen Solarindustrie gefeiert wurde, verbot die WTO den Indern, ihre Solarindustrie gegen Konkurrenz aus dem Ausland abzusichern.
Dabei ist Indien nicht irgendein Land. Das 1,2-Milliarden-Volk baut derzeit so viele Kraftwerke, dass seine Energiepolitik über den Erfolg des internationalen Klimaschutzes bestimmen wird. Ob das Land seine Pariser Versprechen zum Klimaschutz und zur Energiewende umsetzen kann, hängt auch davon ab, ob die Gesetze des Freihandels wieder einmal die Regeln des Umweltschutzes aushebeln.
_____________________________________________________
Der deutsche Journalist BERNHARD PÖTTER (51) schreibt schwerpunktmässig über Klima-, Energie- und Umweltthemen. Er arbeitet seit 1993 für die taz, schreibt aber auch für ZEIT, WOZ, GEO und New Scientist. Zu seinen Buchprojekten gehören «Tatort Klimawandel» (Oekom Verlag) und «Stromwechsel» (Westend Verlag, mit Peter Unfried und Hannes Koch).

Vorsorgeprinzip
Noch muss ein Unternehmen in der EU beweisen, dass sein Verfahren oder Produkt (etwa ein Farbstoff) unschädlich ist, bevor eine Marktzulassung erteilt wird. Ebenso können Staaten vorsorglich etwas verbieten, soweit eine Gefahrenvermutung vorliegt. Mit TTIP stünde das in der EU-Verfassung verankerte Vorsorgeprinzip auf dem Spiel, da es vielen Konzernen beidseits des Atlantiks ein Dorn im Auge ist.
Demokratie & Transparenz
Die Bevölkerung wird in die Verhandlungen nicht einbezogen und unzureichend informiert. Noch ist unklar, ob den nationalen Parlamenten ein relevanter Einfluss bei der Verabschiedung des Abkommens eingeräumt werden wird. Wenn TTIP zustande kommt, würde der vorgesehene Transatlantische Regulierungsrat außerhalb demokratischer Strukturen wichtige Entscheidungen treffen.

Nachhaltige Entwicklung
Sechs der acht international vereinbarten Kernarbeitsnormen, darunter das Recht, sich in Gewerkschaften zu organisieren, haben die USA bisher nicht ratifiziert. Gleiches gilt für mutilaterale Umweltabkommen wie die Konvention über die biologische Vielfalt. Zwar soll TTIP ein Kapitel zu nachhaltiger Entwicklung beinhalten – jedoch ohne eine Verpflichtung für die USA, die erwähnten Normen und Abkommen doch noch zu ratifizieren. Dies hätte eine denkbar schlechte Signalwirkung auf die weitere Staatengemeinschaft.
Daseinsvorsorge
Bereiche der Daseinsvorsorge wie Bildung, Gesundheitswesen, Müllabfuhr und Wasserversorgung sind bei uns noch vielerorts in öffentlicher Hand, unterliegen aber einem Privatisierungsdruck. Im Fall der Wasserversorgung führten Privatisierungen, wie in Potsdam, zu einer Verschlechterung von Wasserqualität und Wassernetz. TTIP würde viele Bereiche der Daseinsvorsorge auch für US-Investoren öffnen und damit das Gewinninteresse der Unternehmen über das öffentliche Interesse an guter und bezahlbarer Versorgung stellen.
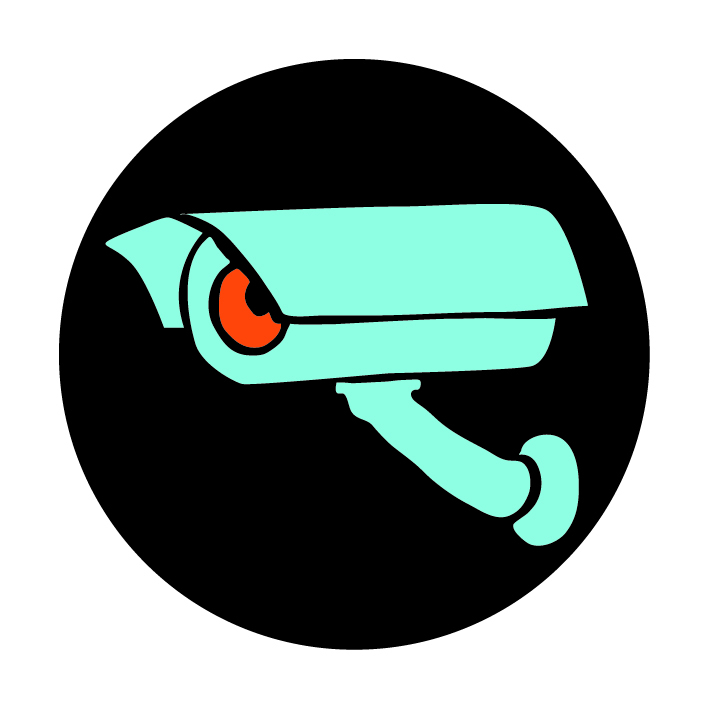
Privatsphäre
Schon jetzt wollen die Konzerne viele private Daten von uns. TTIP würde den persönlichen Datenschutz weiter schwächen und den Unternehmen den Zugang zu unseren Daten erleichtern.
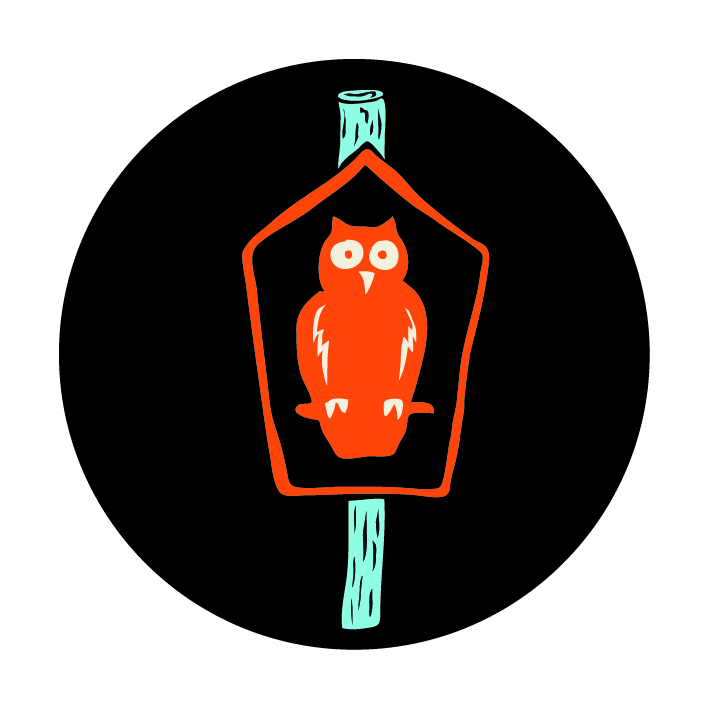
Umwelt & Artenvielfalt
Das Abkommen würde den ozeanüberschreitenden Handel und somit die Zahl der Transporte erhöhen. Die Folgen: höherer Treibstoffverbrauch und mehr klimaschädliche CO2-Emissionen. Regierungen würden sich vermutlich mit der Ausweisung neuer Schutzgebiete (zum Beispiel Nationalparks) schwertun. Schließlich könnten Nutzungsbeschränkungen und -verbote mit den Interessen von Investoren kollidieren.

Kosmetika
Angeglichene und somit niedrigere Standards in der Kosmetikindustrie würden bedeuten, dass wir in unseren Regalen bald Kosmetika mit schädlichen Substanzen vorfinden, die in der EU bereits verboten waren. Auch Produkte, die mit Tierversuchen hergestellt wurden, könnten auf den europäischen Markt kommen.

Landwirtschaft
Wenn infolge von TTIP massenhaft billige Lebensmittel von amerikanischen Industriefarmen den europäischen Markt überschwemmen, könnte dies die hiesigen kleinbäuerlichen und ökologischen Betriebe unter Preisdruck setzen und so existenziell bedrohen.
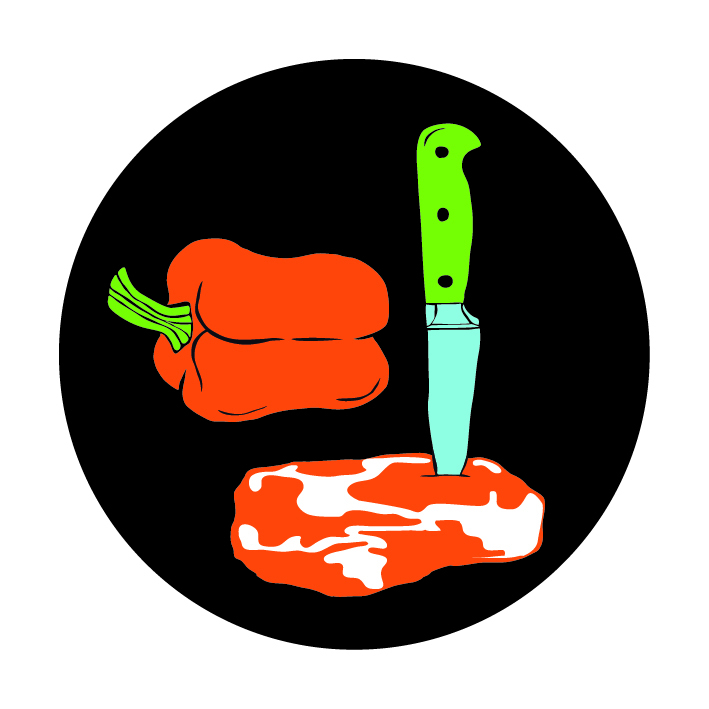
Ernährung
Weniger Schutz vor gefährlichen Pestizidrückständen, gentechnisch veränderten Produkten und unnötigen, unsicheren Lebensmittelzusätzen – diese und andere Verschlechterungen in puncto Ernährung sind zu befürchten.

Textilien
Hier geht es unter anderem um die Frage, welche Chemikalien bis zu welchen Grenzwerten in der Textilproduktion eingesetzt werden dürfen. Womöglich würden die strengen Greenpeace-Kriterien zur Entgiftung von Kleidung auf diesem Weg unterlaufen.

Chemikalien
In der EU muss bisher für die Zulassung von Chemikalien der Nachweis erbracht werden, dass sie sicher sind. In Amerika gilt eine Unbedenklichkeitsvermutung: Bis zum Nachweis des Gegenteils geht man davon aus, dass die Stoffe unschädlich sind. Die strengeren europäischen Standards bei der Zulassung, Beschränkung und Kontrolle von Chemikalien könnten nun abgeschwächt werden. Dies gilt vor allem für Nanopartikel und hormonell wirksame Chemikalien.
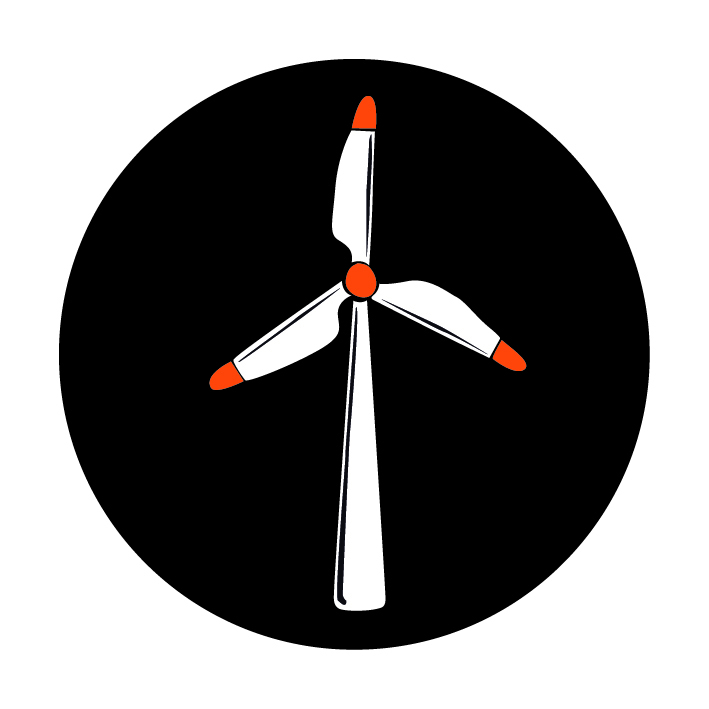
Energie & Klima
Beschränkungen und Nachhaltigkeitsstandards für die Nutzung klimaschädlicher Energieträger, etwa Öl aus Teersanden, könnten als Handelshemmnisse abgeschwächt oder aufgehoben werden. Das geplante Abkommen nimmt auch Einfluss auf die Fracking-Debatte: Einerseits versucht die EU, die Einfuhr von amerikanischem Flüssiggas aus Fracking zu erhöhen. Andererseits sind US- wie auch europäische Konzerne bestrebt, Fracking in Europa zu etablieren. Nationale Verbote gegen Fracking würden so höchst unwahrscheinlich.

Kultur
In Europa gehört die Förderung der Kultur (z. B. Musikclubs, Theater, Programmkinos, Opernhäuser) einschließlich der öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehanstalten zu einer wichtigen am gemeinwohl orientierten Aufgabe. TTIP droht, unsere kulturelle Vielfalt einer reinen Marktlogik zu unterwerfen, die sich nach den Interessen von US-Investoren richtet.

Arbeitsplätze & Arbeitsstandards
TTIP würde den Wettbewerb zwischen der EU und den USA verstärken. Selbst die Europäische Kommission räumt ein, dass dies eine „andauernde und substanzielle“ Verlagerung von europäischen Arbeitsplätzen zur Folge hätte, da mehr Waren aus den USA nach Europa kämen. Bis zu 1,3 Millionen Arbeitsplätze könnten in Europa verloren gehen. Ebenso könnte der erhöhte Wettbewerbsdruck die Situation für europäische Arbeitnehmer verschlechtern, indem Löhne, Rechte und die Sicherheit am Arbeitsplatz sinken.






