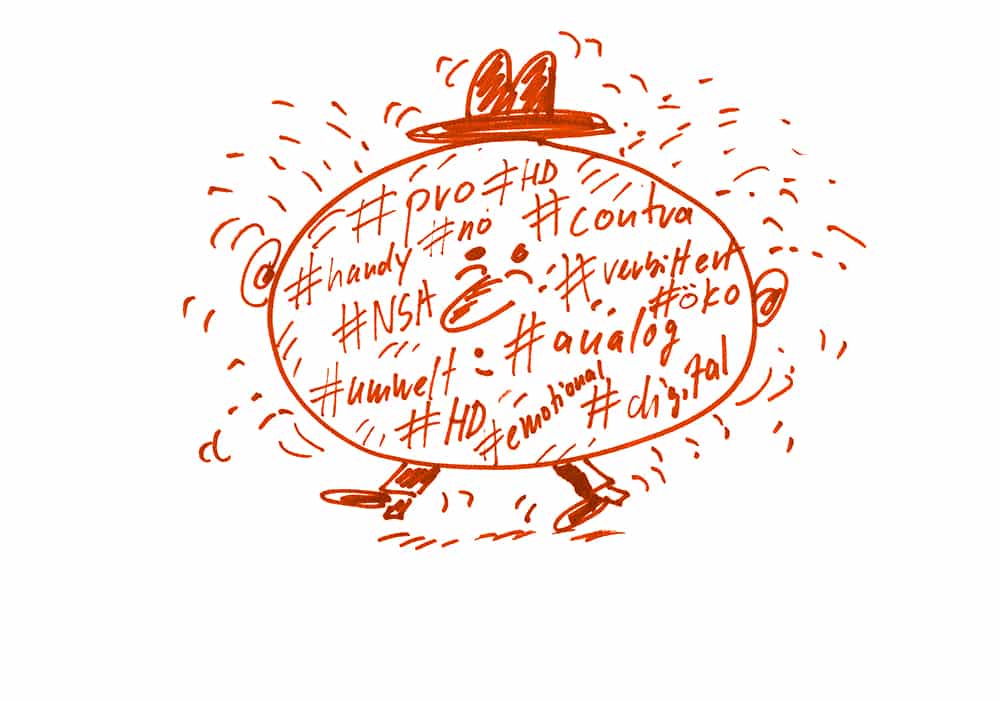Der erste Computer in unserer Familie war ein 8086-IBM-kompatibler PC mit Monochrom-Monitor, MS-DOS, vermutlich einem 8-Mhz-Prozessor und einem 5¼-Zoll-Floppy-Disk-Laufwerk. Das war um 1987 herum. Um eine Stunde spielen zu dürfen, musste ich eine halbe Stunde Zehnfingersystem üben. Die ersten Aufsätze auf dem Computer folgten wenig später, in der dritten Klasse. Die älteste Datei, die noch heute auf meiner Harddisk lagert, datiert vom 28. Juni 1992: eine Schülerzeitung als Abschiedsgeschenk für den Mittelstufenlehrer.
Die erste E-Mail-Adresse, die ich hatte, war keine, wie wir sie heute kennen. Es war eine Nummer, gefolgt von @compuserve.com. Die ganze Familie hat sie sich geteilt, besser gesagt mein Vater und ich, die anderen interessierten sich nicht so sehr dafür. Damals gab es noch keine Browser, jedenfalls nicht bei Compuserve, sondern Foren, wo man sich austauschen konnte. Ich war oft im Musik-Forum unterwegs, habe eigene Musik und Konzertrezensionen hochgeladen und dafür Feedback erhalten. Das war um 1995 / 1996 herum.
Die erste Website, die ich gegen harte Währung gestaltete und programmierte, war 1997 oder 1998 die eines Veloladens im Dorf. Es folgten das Sportgeschäft und der Musikladen — noch vor Jecklin und Musik Hug. Für 500 Franken plus eine Veloreparatur. Oder 500 Franken plus einen Gaskocher. Inzwischen sind wir längst über HTML hinaus. Alles ist interaktiv geworden — und ich muss nur noch Bausteine zusammensetzen. 1999, auf Druck meines Vaters, folgte mein erstes Natel: ein Nokia, weinrot.
Das erste Smartphone, das ich mein Eigen nannte, war — nun, ich besitze immer noch kein Smartphone. Während meine Mutter eifrig Fotos und Videos mit meiner Tante und meinem Onkel in Nordnorwegen austauscht, kriege ich diese nur beim Familienznacht zu sehen. Aber das ist schon in Ordnung. Ich traue den Dingern sowieso nicht über den Weg. Und ich verstehe immer noch nicht, weshalb Programme und Software nun plötzlich Apps heissen.
Mein erster Artikel, der über eine App verfügbar war, erschien in der letzten Ausgabe des Greenpeace-Magazins. Ich hatte mich darauf gefreut, das Heft in der Hand zu halten, die Druckfarbe zu riechen, das Papier abzutasten, es mit ins Bett zu nehmen, durchzulesen und anschliessend zu meinen Belegexemplaren zu legen. Weit gefehlt! Man spare Papier, hiess es. Es sei ein Bedürfnis von vielen Leserinnen und Lesern. Schon wieder eine App, die mich ausgrenzt.
Bin ich nostalgisch? Altbacken? Verbittert? Technologiefeindlich? Ich könnte hier zu einem Loblied auf die Taktilität von Druckerzeugnissen ansetzen, auf ihre hohe Auflösung, darauf, dass sie nicht aufgeladen werden müssen und im Bücherregal aufgereiht schmuck aussehen sowie Bildung und Intellekt vermitteln. Doch ich will auf etwas anderes hinaus.
Wenn Greenpeace schreibt, man würde Papier sparen, stimmt das wohl. Jedes Mal, wenn von Digitalisierung die Rede ist, so scheint mir, ist eine gewisse Immaterialität mitgedacht. Daten sind in den Wolken, E-Mails bestehen aus Nullen und Einsen, genauso wie Musikalben, Hollywoodfilme und Bücher. Meine ganze DVD-, CD- und E-Book-Sammlung hat auf einer Harddisk Platz — und sie ist keineswegs voll. Das sind viele, viele Kubikmeter Material. Doch bei der Rede von der Digitalisierung, dem Sparen von Papier, der Verfügbarkeit per Knopf- oder Fingerdruck geht vergessen, dass dies alles keineswegs immateriell ist.

Ein schmutziges Geschäft
Die Daten in den Wolken sind auf riesigen Serverfarmen gelagert, die grosse Mengen Energie zur Stromversorgung und zur Kühlung brauchen. Um Prozessoren, Speichermedien, Gehäuse oder Kameras herzustellen, braucht es Rohmaterialien: Erdöl, Silikon, seltene Erden, Metalle, Quarze. Es ist nicht nur harte und gefährliche Arbeit, diese zu fördern, sondern auch ein knallhartes Geschäft, an dem sich zweifelhafte Unternehmen ohne Sinn für soziale und ökologische Nachhaltigkeit die Finger schmutzig machen.
Um die Computer zu vernetzen, werden Gräben aufgerissen, Kupferkabel und Glasfasern verlegt, die Gräben wieder zugeschüttet und asphaltiert. Es werden Satelliten in Umlaufbahnen geschossen und Mobilfunkantennen auf Kirchtürmen errichtet. Riesige Fabriken produzieren Geräte, die in zwei Jahren veraltet sind und zur Rückgewinnung der Stoffe sorgfältig zerteilt werden — wenn sie denn nicht in Ghana auf der Müllhalde landen. Die Kosten für die Fantasie der Cloud, der Nullen und Einsen, ist eine Materialschlacht, die wenigVergleichbares kennt. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar — auch vor dem Bildschirm. Der Weg von der Kupfermine bis zu unseren Fingerspitzen und zurück in die Einzelteile ist gesäumt von Toten und Geschädigten, von Kinderarbeit, Ausbeutung, Überschuldung und schamloser Bereicherung. Es gibt keine Fairtrade- und Biolabels für Unterhaltungselektronik.
Und was geschieht mit den Daten, mit den Kabelnetzwerken und den kabellosen Verbindungen? Inzwischen wissen wir, dass die ärgsten Befürchtungen der schlimmsten Paranoiker wahr geworden sind. Wir werden überwacht, entschlüsselt, auf Vorrat gelagert. Aus Webcam-Bildern werden 3-D-Modelle von Räumen und Benutzern zusammengesetzt. Videokamera-Software erkennt Menschen an ihren Gesichtern oder an ihrem Gang. Satelliten messen Vibrationen von Fensterscheiben und übersetzen sie in natürliche Sprache. Selbstlernende Algorithmenscannen gewaltige Datenmengen auf Schlüsselwörter. Konten von sozialen Medien werden miteinander abgeglichen, um ein vollständiges Bild zu erhalten, und Benutzerinformationen werden vergoldet oder verscherbelt. In dieser Perspektive wird das spurlose Verschwinden einer Boeing 777 perverserweise zu einem Hoffnungsschimmer.
Aber auch ohne Smartphone, auch ohne Apps von Greenpeace, Tinder und Youtube hat mich die Technologie fest im Griff. Ein Tag ohne Internet oder ohne Computer ist kaum denkbar. Ständig schaue ich, ob mich jemand angeschrieben hat oder was die Tageszeitungen zu berichten wissen. Letztes Jahr habe ich mich in die Blockhütte meiner Grossmutter in Norwegen zurückgezogen. Ein See, ein paar Ferienhäuser, zwei Bauernhöfe, kein fliessendes Wasser, kein Telefon, kein Internet. Kein Internet? Ein schwaches Signal kam über den See, kaum genug, um etwas zu versenden, aber gerade ausreichend, um ab und zu E-Mails abzurufen. Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen. Einmal bin ich sogar über den See gerudert, um einen besseren Empfang zu haben.
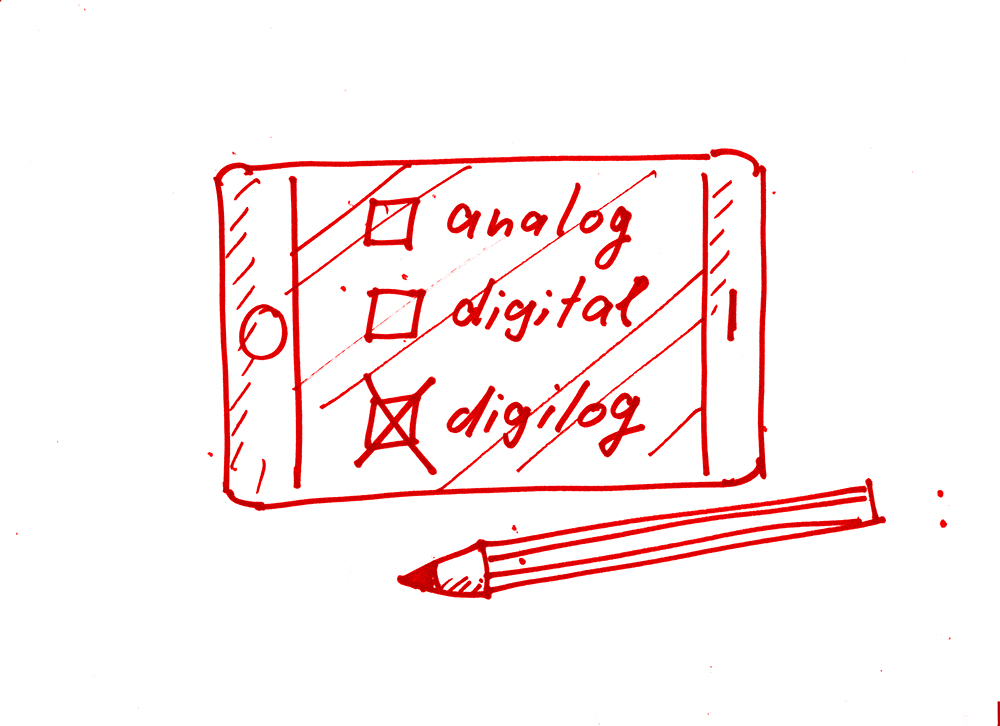
Gnadenlose Durchdringung
Das Problem der Digitalisierung ist die gnadenlose Durchdringung aller Aspekte der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Bildung sowie die Normalisierung, das Nicht-mehr-anders-Können. Hier folgt die Digitalisierung dem Kapitalismus. Es gibt allerdings auch Erfolgsgeschichten wie die Vernetzung von Aktivistinnen und Protestbewegungen. Die Zusammenarbeit über nationale Grenzen hinweg. Medizinische Fortschritte. Die Aufrechterhaltung von fernen Freundschaften. Die Steuerung des Bahnverkehrs. Der Komfort. Doch dies ist alles nicht gratis. Es geht nicht ohne Materialverschleiss. Es geht nicht ohne Verlust der Privatsphäre. Es geht nicht ohne die Entwicklung von Abhängigkeiten.
Der deutsche Philosoph Martin Heidegger hat sinngemäss geschrieben, dass das Rettende der Technologie ihre grösste Gefahr für die Menschheit darstelle. Das kann man auch in die andere Richtung lesen, wie es Friedrich Hölderlin tut: «Wo aber Gefahr ist, wächst/Das Rettende auch.» Die Technologie hat beide Seiten. Es besteht Hoffnung, aber Misstrauen, Aufklärung, Vorsicht und Widerstand sind angebracht, denn es ist keine unbelastete Option mehr, Digital Native zu sein.
Zur Person: Christian Hänggi — Der Medienökologe und freiberufliche Texter unterrichtet gelegentlich Medien- und Kommunikationsfächer an der Ramkhamhaeng University in Bangkok sowie zeitgenössische amerikanische Literatur an der Universtität Basel. Er ist Autor des Buchs Gastfreundschaft im Zeitalter der medialen Repräsentation. Zuvor hat er regemässig auf blog.persoenlich.com gebloggt und ab 1997 zahllose Websites konzipiert, programmiert und betextet.
Auf unsere Textanfrage an Philip Meier, ehemaliger Clubkurator und Kodirektor des Cabaret Voltaire und gemäss Klout / Kuble unangefochtener Social-Milieu-König und Digital Nerd, schrieb er uns: Im Prinzip reicht ein Satz: «Was nicht online ist, existiert nicht.»